LESE.PROTOKOLL
***** hervorragend **** lesenswert *** Licht und Schatten
** nur bedingtes Vergnügen * überflüssig

Tijan Sila: Radio Sarajevo (Roman) ****
Hanser Verlag (Berlin 2023)
ca. 170 Seiten, 22.00 Euro
Menschen mit Migrationshintergrund haben meist etwas zu erzählen. Aktuell könnte man als Beispiele Nadine Schneider, Martin Kordic oder Cihan Acar nennen, die über ihre ehemalige Heimat (Rumänien, Kroatien, Türkei) bzw. über die Probleme der Integration in ihrer neuen Heimat Deutschlands geschrieben haben. In diese Liste passt auch Tijan Sila, der mit seinem vierten in Deutschland erschienenen Roman „Radio Sarajevo“ einen Rückblick auf den Balkankrieg ab 1991 wagt, den er als Zehn- bis Zwölfjähriger erlebte.
Er erzählt von einem Bombeneinschlag in den Plattenbau-Komplex, der der vierköpfigen Familie Sila vermittelt: „Der Krieg ist da“. In einer mickrigen 40qm-Wohnung leben: der Vater, Uni-Professor für Bibliothekswissenschaft, die Mutter, gerade an einer Germanistik-Promotion arbeitend, der Autor und sein damals vierjähriger Bruder. Der Vater ist mit dem zwielichtigen Muhamad befreundet, der die Familie durch seine Beziehungen und seine clevere Beschaffungs-Kriminalität unterstützt. Stellvertretend für die Gleichaltrigen des Viertels stehen Sead und Rafik, die engsten Freunde. Man erfährt von Bekannten, die rechtzeitig abgehauen sind, denn Sarajevo wurde - in der erwachsenen Perspektive des Verfassers - zu einem schwarzen Wald mit dem „Tod als Jäger“. Ein verbleibendes Symbol des Friedens und der (westlichen) Freiheit ist die Hard Rock Musik im Radio Sarajevo, so man denn ein funktionierendes Gerät hat.
Silas Roman konzentriert sich hauptsächlich auf die Auswirkungen des Krieges auf Jugendliche („wir stumpften immer mehr ab“), die Kriegstote auf der Straße liegen sehen, die statt provisorischem Unterricht in Not-Baracken mit Pornoheften bei UN-Blauhelmen handeln, sich für Mädchen und Kleber-Schnüffeln interessieren und von einem prügelnden Hilfslehrer gequält werden.
Die Eltern sind als Akademiker Außenseiter, stehen als muslimisch-katholisches Paar zwischen den Fronten - sie beschließen schließlich eine Flucht nach Deutschland, denn Sarajevo sehen sie als „abstürzendes Flugzeug“. Die Fluchtroute geht über Zagreb nach Mannheim, wo sie einen Platz in einem Studentenwohnheim bekommen und Tijan die Klasse 7b des Gymnasiums besuchen darf.
Der Roman endet mit einem Besuch in Sarajevo - 25 Jahre später. Er trifft seine alten Bekannten Rafik (Häftling auf Freigang), das Mädchen Mensiha (Callgirl) und Sead (jetzt Makler), der ernüchtert feststellt: „der Krieg hat niemals aufgehört“.
Silas Text überzeugt durch authentische Darstellung („alles ist wirklich passiert“ heißt es im Nachwort) mit poetischer Schaumkrone, durch den lakonischen Blick eines Erwachsenen im Körper eines Jugendlichen. Es ist die Skizze einer verlorenen Generation, die vom Krieg aus der Bahn geworfen wurde. Für den Verfasser eine rückwärts gerichtete Reflexion, für den deutschsprachigen Leser ein weiterer Erfahrungs-Baustein in Zeiten der zunehmenden Kriege.
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/tijan-sila-radio-sarajevo-9783446277267-t-3968

Uwe Wittstock: Marseille 1940. Die große Flucht der Literatur
C. H. Beck Verlag (München 2024)
ca. 350 Seiten, 26,00 Euro
Nach seinem kundigen Blick auf die verbrannten Dichter („Februar 33. Der Winter der Literatur“) erzählt Uwe Wittstock nun von den flüchtenden Literaten (und sonstigen Intellektuellen und Künstlern), die glaubten in Frankreich eine sichere Zukunft gefunden zu habe. Doch das Vorrücken der deutschen Armee im Mai 1940 machte diese Zuversicht zur Illusion: eine zweite Flucht, weg von Europa schien unvermeidbar. Uwe Wittstock verfolgt tagebuchartig die prekären Über-Lebens-Situationen von Lion Feuchtwanger, Heinrich Mann, Golo Mann, Franz Werfel, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Max Ernst, Walter Mehring, Ernst Weiß, Alfred Kantorowicz, Anna Seghers, Ilja Ehrenburg, Leonhard Frank, Rudolf Breitscheid, Rudolf Hilferding und manchen anderen.
Die eigentliche Hauptperson des Buches ist aber der US-Amerikaner Varian Fry, der im Auftrag des Emergency Rescue Komitees in Marseille eine Art Fluchthilfe-Organisation aufbaute, um prominenten Künstlern die Ausreise nach USA (oder nach Mexiko oder nach Brasilien) zu ermöglichen. Dies konnte in wenigen Fällen direkt per Schiff aus der pulsierenden Hafenstadt funktionieren, eine eher beschwerliche Alternative war der Landweg nach Spanien mit einer kleinen Pyrenäen-Bergtour. Varian Fry war in der Lage, auf ein stattliches, in USA gespeistes Spendenkonto zurückzugreifen, machte sich aber bei Sponsoren und bei der Vichy-Regierung teilweise unbeliebt, weil er Visa fälschen ließ oder weil er auch Stalin-treue Kommunisten unterstützte.
Die Schicksale der Flüchtenden entwickeln im Tagesrhythmus zunehmend Spannung, neben erfolgreichen Fluchten ist auch vom Scheitern, von Selbstmorden, von schweren Krankheiten, von persönlichen Animositäten und von nervenaufreibenden Wartezeiten zur reden. Gleichzeitig lädt dieses unterhaltsame historische Kaleidoskop auch zu einem Vergleich mit aktuellen Fluchtbewegungen ein: würde man heute Mr. Fry als Chef einer kriminellen Schleuser-Organisation denunzieren? Kann man die Einreisebedingungen und -regelungen der ZUSA aus heutiger Sicht noch als human bezeichnen? War es - wie heute - so, dass letztlich die (finanziell) Stärkeren und die Prominenten mehr „Erfolg“ beim „Transit“ hatten?
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet Wittstock vollkommen auf Fußnoten, lädt aber mit seiner umfassenden Leseliste zur Vertiefung des Themas ein.
https://www.chbeck.de/wittstock-marseille-1940/product/36359417

Bernhard Schlink: Das späte Leben (Roman) ***
Diogenes Verlag (Zürich 2023)
ca. 240 Seiten, 26,00 Euro
Ab einem gewissen Alter blickt man auf die letzten Dinge. Martin Walser hat zum Beispiel mit 89 den Roman „Ein sterbender Mann“ vorgelegt, in dem er den 72jährigen Unternehmer Theo Schadt zur Hauptperson machte, der nach einem Konkurs seiner Firma den Frei-Tod erwägt. In Wahrheit ist Schadt aber noch recht munter, spielt mit einer gewissen Altersnarrheit und nutzt diese Rolle zur Ironisierung gesellschaftlicher Kreise (hier der Münchner Kultur-Schickeria). So wird aus dem schweren Titel eher leichtfüßige Literatur.
Ganz anders bei dem neuesten Roman von Bernhard Schlink. Als 80jähriger Autor erfindet er den 76jährigen Martin Brehm, der in seiner Vita auffallende Parallelen zu Schlink hat, nun aber vor einer existenziellen ärztlichen Diagnose steht: Bauspeicheldrüsenkrebs, das harsche Todesurteil mit einer Lebenserwartung von höchstens noch einem halben Jahr. Daraus entwickelt Schlink jedoch kein Beckettsches Endspiel, sondern eher konventionelle Reflexionen zu der beherrschenden Frage „Wie nutze ich die verbleibende Zeit?“
Brehm hat eine deutlich jüngere Frau (Ulla) und einen sechsjährigen Sohn (David), der noch in den Kindergarten geht. Diesem jungen Menschen will er einer Art Vermächtnis in Form von letzten Erörterungen hinterlassen: er reflektiert sein Verhältnis zu Gott und zur Religion, erläutert die Ungerechtigkeit der Liebe, die Wichtigkeit von Arbeit und die Unabwendbarkeit des Todes. Brehm konstatiert nüchtern: „Was ich für ihn schreibe, erreicht ihn oder erreicht ihn nicht“.
Auf einer anderen Ebene wird Brehm trotz zunehmender Müdigkeit zum Detektiv. Er forscht seiner Frau nach, die eine Beziehung zu einem anderen Mann hat. Und er will die Geschichte von Ullas Vater ans Licht bringen, der die Familie kurz nach Geburt seiner Tochter spurlos verlassen hatte. Beides kommt zu einem Ergebnis, ohne dass sich dadurch die Situation von Martins Ehe wesentlich ändert. Im dritten Teil des Romans verbringen die beiden noch einen stimmungsvollen Urlaub an der Ostsee, bevor Martin sich selbständig in einem Hospiz anmeldet.
Der Roman wirkt sprachlich zu glatt und erzähltechnisch sehr routiniert, der Titel verweist auf den Versuch, dieser prekären Lebensphase noch etwas Positives, möglicherweise Tröstliches abzugewinnen. Da hatte Martin Walser seinerzeit eine provokativere Herangehensweise an das Thema erprobt und in jeder Hinsicht mehr Spannung erzeugt. Das findet jedenfalls der Verfasser dieser Zeilen (73 Jahre alt).
https://www.diogenes.ch/leser/titel/bernhard-schlink/das-spaete-leben-9783257072716.html

Jon Fosse: Ein Leuchten ***
aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel
Rowohlt Verlag (Hamburg 2024); Originalausgabe: Oslo 2023
ca. 75 Seiten, 22,00 Euro
Da steht man nun mit einer gewissen Ehrfurcht vor dem Namen des Autors, der den Literatur-Nobelpreis 2023 erhalten hat. Das Komitee rühmte Jon Fosse für seine innovativen Theaterstücke und Prosawerke, „die dem Unsagbaren eine Stimme geben“. Er stelle alltägliche Situationen dar, die wir in unserem eigenen Leben sofort wiedererkennen. Seine radikale Reduktion von Sprache und dramatischer Handlung drücke die stärksten menschlichen Emotionen von Angst und Ohnmacht in einfachsten Worten aus. Seine Fähigkeit, die Orientierungslosigkeit des Menschen darzustellen und zu zeigen, wie diese paradoxerweise Zugang zu einer tieferen, dem Göttlichen nahen Erfahrung verschaffen kann, habe ihn als preiswürdig markiert.
Man kennt (und schätzt) einige seiner Theaterstücke und wagt sich mit gebotener Vorsicht an einen ganz aktuellen Text, der mit etwa 75 Seiten bestenfalls als Erzählung bezeichnet werden kann. Auf dieser kurzen Lese-Etappe ohne Absätze, Zwischenräume oder Kapitel-Einteilungen erlebt man einen männlichen Ich-Erzähler, der sich in eine existenzielle - um einen literarischen Vergleich zu bemühen wäre auch das Adjektiv „kafkaesk“ naheliegend - Situation gebracht hat. Aus Langeweile setzte sich der Single-Mann ins Auto, fuhr ziellos dahin, bis er auf einen einsamen Waldweg gerät, in dessen tiefen Fahrspuren sich das Auto festbeißt.
Ab diesem Moment beginnen gefühlte Beklemmungen und relativ unorganisierte Reflexionen, über die Frage, wie es zu dieser Notlage kommen konnte. Es beginnt zu schneien, der Ich-Erzähler steigt aus, sucht nach Hilfe, wird aber schnell müde, zittert vor Kälte, setzt sich auf einen Stein und erkennt, dass er so erfrieren wird: „Ich will ja nicht sterben!“
Plötzlich nähern sich imaginäre Erscheinungen: ein weiß leuchtender Umriss, eine undefinierbare Gestalt, vielleicht ein von Gott gesandter Engel oder doch nur eine schräge Halluzination? Redundante Dialoge mit der Gestalt führen nicht weiter. Dann tauchen möglicherweise zwei Menschen im Wald auf: ein älteres Paar, das sich Mutter und Vater des Ich-Erzählers erweist. Die beiden machen sich Sorgen um den verirrten, verlorenen Sohn: „du musst heimgehen“. Den Weg wissen sie aber auch nicht. Ausweg-Losigkeit! Auch ein Mann im schwarzen Anzug und weißem Hemd, vielleicht ein barfüßiger Totengräber wird sichtbar. Die Gestalten vereinigen sich zu einem Gesamtbild, zu einem Leuchten mit ausgestreckten Händen („komm mit“), dem der Mann in ein leeres Nichts folgt.
So fügt sich ein symbolgeladenes, verrätseltes Endspiel, das natürlich auf die Selbstbezeichnung Jon Fosses als religiöser Schriftsteller verweist und in dem Kontext eines postmodernen nordischen Naturalismus verfasst ist. Weil aber das sprachliche Niveau dieses Geschehens immer auf einer banalen Oberfläche bleibt, stellt sich eher Langeweile, denn thematische Sogkraft ein. Da hat der vor 100 Jahren gestorbene Herr K. mit seinen Erzählungen eine viel intensivere Einladung zu Interpretationen geschaffen, einen Preis hat er dafür zu Lebzeiten nie bekommen.
https://www.rowohlt.de/buch/jon-fosse-ein-leuchten-9783498003999

Tine Melzer: Alpha Bravo Charlie (Roman) ***
Jung und Jung (Salzburg 2023)
ca. 125 Seiten, 21,00 Euro
Unter den Danksagungen am Ende des Buches findet sich die ehemalige Deutschlehrerin eines Gymnasiums in Nürnberg. Möglicherweise hat Tine Melzer dort als Schülerin in den 1990er Jahren lehrplangemäß folgenden Arbeitsauftrag erhalten: Verfassen Sie eine literarische Charakteristik von Walter Faber (oder vom Vater der Effi Briest, von Michael Kohlhaas oder vom Tambourmajor in Büchners „Woyzeck“). Belegen Sie Ihre Erkenntnisse durch Zitate aus den einschlägigen Primärtexten.
Seitdem sind über zwanzig Jahre vergangen, Tine Melzer lebt nach Stationen in Deutschland und den Niederlanden derzeit in Zürich und hat einen Lehrauftrag an der Hochschule für Kunst in Bern. Doch in Ihrem späten Debütroman schimmert die Aufsatzform der Schulzeit wieder durch. „Alpha Bravo Charlie“ ist die Charakteristik eines älteren weißen Mannes, natürlich keine Figur aus der kanonischen Literatur, sondern eine von der Autorin imaginierte Hautperson namens Johann Trost. Melzer braucht dafür 125 Seiten, 17 Kapitel und genau einen Tag (von 9.17 Uhr bis 21.59 Uhr) um den verrenteten Flugzeugkapitän in seiner Alltags-Routine und in Passagen seiner Vorgeschichte vorzustellen. Die Berufsgruppe kennt man aus diversen Filmen eigentlich als attraktive Strahlemänner (z. B. Leonardo di Caprio in „Catch Me If You Can“ oder Tom Cruise in „Top Gun“), Johann Trost aber ist zu einem kauzigen, menschenscheuen und misanthropischen Einzelgänger geworden, der in der Ich-Form seine Lage als sinnsuchender Single erörtert. Vor zehn Jahren hast sich seine Frau von ihm getrennt, die Ehe ist kinderlos geblieben, Kontakte zu ehemaligen Arbeitskollegen sind weitgehend eingeschlafen. Solche Menschen könnten auch den Prosatexten von Robert Walser oder Thomas Bernhard entsprungen sein.
Wenn Trost in den Spiegel schaut, sieht er einen trostlosen, alten Mann, geprägt von Verfall und Nutzlosigkeit. Es gibt noch ein paar Tagesroutinen wie den Mittagsschlaf im verdunkelten Zimmer, den allwöchentlichen Kauf von Schnittblumen, Spaziergänge in der Fußgängerzone, Aggressions-Abbau am Kinderspielplatz, Besuche beim Hausarzt und abendliche Wein-Absacker in einer Hotelbar. Immerhin hat er ein Hobby gefunden: auf dem großen Küchentisch entwirft er eine idyllische Modellbau-Landschaft - für ihn eine „Flucht in die Harmlosigkeit“.
Erst auf den letzten Seiten des schmalen Roman-Bändchens entsteht die Möglichkeit einer Handlungs-Entwicklung. Es klingelt an der Wohnungstür, ein fremder Mann steht davor. Da Trost sich nach einem Blick durch den Spion nicht in der Lage sieht zu öffnen, hinterlässt der unangemeldete Besucher eine Flasche Wein, eine kleine Schachtel und einen Brief. Es ist der Besitzer des Modellbau-Geschäfts, der Trost einen ganzen Tag lang verfolgt und beobachtet hat: „Ich bin bald in Rente und vielleicht fünf Jahre jünger als sie … wollte mich ihnen vorstellen, und wagte es nicht“.
Der Roman ist noch nicht der große Wurf, eher eine assoziative Miniatur, stilistisch ansprechend, aber in der Konstruktion der Hauptperson etwas beliebig. Vom Deutschlehrer gibts die Note befriedigend - aber das sollten literarische Text auf gar keinen Fall sein!

Felix Lobrecht: Sonne und Beton (Roman) ****
Ullstein Verlag (Berlin 2023, 18. Aufl.); Erstauflage 2018
ca. 220 Seiten, 12,99 Euro (Tb)
Die Liste der literarischen (und filmischen) Blicke auf das Sünden-Babylon Berlin lässt seit knapp 100 Jahren an drei höchst unterschiedlichen Texten illustrieren. Es beginnt mit Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ (1929), erlebt eine späte Fortsetzung in „Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ (1968) und mündet vorläufig in Felix Lobrechts aktuelle Milieu-Studie „Sonne und Beton“ (mittlerweile auch schon von David Wnendt verfilmt). Die beiden letzten Titel haben natürlich keine Ambition, sich an dem großen Klassiker des modernen Romans zu messen, sind aber bei einer örtlichen Verlagerung nach Berlin Gropiusstadt (Neukölln) und einer deutlichen Verjüngung der Protagonisten aufschlussreiche und gleichzeitig traurig stimmende Perspektiven auf die Welt des jeweiligen Prekariats in der deutschen Metropole.
Bei Lobrecht sind die vier männlichen Hauptpersonen etwa 15 Jahre alt, Schüler, geprägt von weitgehend kaputten Familienverhältnissen und einer deprimierenden Ghetto-Urbanität. Der Alltag von Ich-Erzähler Lukas, von Julius, Gino und Sanchez ist definiert durch Drogen, Alkohol, Ladendiebstählen, ethnischen Konflikten, Gangster-Rap und dem Versagen der traditionellen Autoritäten. Stattdessen herrscht im Viertel das Recht des Stärkeren und der Gott des Gemetzels, mal zieht man jemanden ab, mal wird man selbst abgezogen, mal ist man das Opfer, mal wird man gestützt durch organisierte Gangs, mal wird man gefickt, mal fickt man andere. Ohne Messer, Totschläger oder Schreckschuss-Revolver ist man bei den Verlierern im alltäglichen rechtsfreien Überlebenskampf. Die Sprache der Jugendlichen, die der Autor vor Ort studiert hat, ist eine Mischung aus Kanak Sprak (der Feridun Zaimoglu schon 1995 ein Denkmal gesetzt hat) und Arab-Rap; wer kundig mitlesen will, muss das ABC von cüüs über Dicker, lak und wallah verstehen, sonst geht ganz schön Dings, äh Authentizität verloren - ich schwöre!
Im Unterricht an der Gesamtschule Neukölln herrscht Chaos und Anarchie - jedoch nicht ganz so klaumaukig wie bei „Fack ju Göhte“. Selbst als der Direktor mit der freudigen Botschaft ausrückt, der Berliner Bildungssenat habe 50 neue Computer spendiert, löst das bei den Jungs nur einen destruktiven Plan aus: wir klauen die Dinger und verscherbeln die Scheiße! Lukas meldet immerhin Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Projekts an, wird von den anderen aber überstimmt. Die amateurhafte Durchführung und der schwierige Weiterverkauf des Diebesguts, führen dazu, dass es am Ende nur Verlierer gibt und der Roman nach einem blutigen Auftakt auch ein blutiges Ende im Klinikum Neukölln findet.
Felix Lobrecht hat unbestreitbare street credibility und bemüht sich um erzählerische Spannung und um einen neutralen, schnörkellosen Realismus. Es geht nicht um Szene-Satire, erst recht nicht um Kiez-Idylle. Am Ende steht - wie bei Franz Biberkopf oder bei Christiane F. - eine eindeutige Lose-Lose-Situation, die zu gesellschaftlichem Nachdenken zwingt.
https://www.ullstein.de/werke/sonne-und-beton/taschenbuch/9783548290584

Thomas Niedzwetzki: Der Unterton ***
Grünberg Verlag (Weimar & Rostock 2023)
ca. 350 Seiten, 24,80 Euro
Die Zeit der Wende in der DDR ist etwa dreiunddreißig Jahre her, zahlreiche kleine und große Wenderomane wurden geschrieben - ist es da nicht etwas spät, jetzt noch einmal mit dem Thema zu kommen? Doch Thomas Niedzwetzki (Jahrgang 1966 und damit beim Mauerfall 23 Jahre alt) hat das Schreiben nie zum Broterwerb gemacht, war eher leidenschaftlicher Musiker (Schlagzeug und Gitarre) und erfolgreicher Bauingenieur, der sogar ein eigenes Unternehmen in Rostock auf die Beine gestellt hat (Erneuerbare Energie Teetzleben GmbH & Co.). Doch wenn einen das literarische Schreiben so gepackt hat, kann man auch im Alter von 54 Jahren noch beginnen, den Debütroman zu Papier zu bringen - noch dazu, wenn man wirklich einiges zu erzählen hat.
So präsentiert uns Niedzwetzki sein fiktional aufgemotztes Alter ego namens Jo (= Josef Terowski), der gleichzeitig zwei schicksalhafte Lebensphasen verarbeiten muss: das Coming of age und die Wendezeit der 80er Jahre in der DDR. Seine Jugend ist geprägt vom Musikmachen und vom Musikhören, seine zeitgeschichtlichen Hintergrundgeräusche sind der Dienst bei der NVA, die Aufforderung zur Stasi-Mitarbeit, dann aber auch der Kontakt mit regimekritischen Personen.
Wie eng Musik und Politik zusammenhängen können, wird Jo nur häppchenweise bewusst: Sein großes Idol ist Bruce Springsteen (und dessen Drummer Max Weinberg), aber darf man einen Rock-Star aus dem Musterland des Kapitalismus und des Imperialismus mögen? Die Tatsache, dass man „Born in the GDR“ ist, bringt ja nicht unbedingt „Glory days“ mit sich! Viele Kulturhistoriker sagen, dass mit dem Live-Konzert von Bruce Springsteen in Weißensee (19. Juli 1988) der erste Stein aus der Mauer gezogen wurde, auf der dann David Hasselhoff mit Bierzelt-Musik „I`ve been looking for freedom“ trällerte.
Wichtig für Jo ist besonders die Beziehung zu der US-Studentin Deborah, die in Rostock sozusagen das soziologische Experiment einer geschlossenen Gesellschaft erlebt. Über Deborah lernt Jo Umweltaktivisten und kirchliche Friedensgruppen kennen, die auch Republikflüchtlinge unterstützen. Damit gerät er in die Überwachungsnetze der Stasi, symbolisiert durch den Karrieristen-Offizier Hadrich. Jo verbringt einige Tage im Stasi-Gefängnis; als sich aber die Grenzen der DDR in Ungarn öffnen, werden politische Gefangene freigelassen. Tragisch erweise nützt das seinem Freund Ben nichts mehr, denn der ist im Gefängnis an einem Asthma-Anfall gestorben.
Bei einem ambitionierte Hobby-Schreiber kann man nicht die feine Ironie eines Thomas Brussig (z. B. „Helden wie wir“) oder eines Jens Sparschuh („Der Zimmerspringbrunnen“) erwarten, und die großen Wende-Romane von Uwe Tellkamp, Eugen Ruge oder Lutz Seiler spielen sowieso in einer anderen Liga. Dennoch lohnt sich die Lektüre von Niedzwetzkis Roman für alle, die noch einmal differenziert auf Musik und Politik der 1980er Jahre in der DDR zurückblicken wollen und die Verpackung einer zeitlosen Coming-of-age-Story mögen.

Martin Kordić: Jahre mit Martha (Roman) ****
S. Fischer Verlag (Frankfurt/Main 2022)
ca. 290 Seiten, 24,00 Euro (als TB 14,00 Euro)
Aus dem Film „Harold und Maude“ und aus Bernhard Schlinks Bestseller „Der Vorleser“ kennen wir das Motiv: junger Mann liebt ältere Frau - oder auch umgekehrt. Eine neue Variante dieses literarischen Topos präsentiert nun Martin Kordić in seinem zweiten Roman „Jahre mit Martha“ - und kann damit enorm beeindrucken.
Der Text ist weit mehr als eine problematische Liebesgeschichte, er ist auch die Schilderung der Irrwege eines jungen Erwachsenen, er ist dazu ein aktuelles deutsches Gesellschaftspanorama zwischen Arm und Reich, und er ist ein treffendes Schlaglicht auf die Schwierigkeiten von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland - in diesem Fall einer kroatischen Familie, stammend aus Bosnien-Herzegowina.
Die männliche Hauptperson heißt Željko Draženko Kovačević - von allen nur Jimmy genannt -, er lebt mit seiner Familie in Ludwigshafen. Der Vater ist Bauarbeiter und meist auf Montage unterwegs, die Mutter arbeitet als Putzfrau, dazu kommen noch der ältere Bruder Kruno und die jüngere Schwester Ljuba. Die Familie hat sich in Deutschland vorbildlich integriert, Jimmy spürt aber als ehrgeiziger Schüler (zu seinem Bruder sagt er einmal „Wir müssen besser sein. Wir müssen die Besten sein“) immer wieder diskriminierende Situationen; wenn man ihm etwa im Berufsinformationszentrum das Abitur nicht zutraut und ihm lieber eine Gärtnerlehre empfiehlt.
Dann lernt er als 15jähriger die 40jährige Frau Gruber kennen, eine Professorin aus Heidelberg, bei der seine Mutter putzt. Die gut gefüllte Hausbibliothek der Grubers ist für ihn eine potentielle Quelle, um ein kluger Mensch zu werden. Bisher kannte er von zu Hause nur die Bibel und Günther Wallraffs Doku-Roman „Ganz unten“, jetzt kauft er sich noch ein Duden-Lexikon und - sehr zufällig? - einen Gedichtband der weitgehend unbekannten Österreicherin Hertha Kräftner, die 1951 im Alter von 23 Jahren ihrem Leben ein Ende setzte.
Zwischen Jimmy und Martha entwickelt sich eine sehr volatile Beziehungsgeschichte, sie ist seine vor allem finanzielle Förderin, die ihm aber letztlich alle Freiheiten für die eigenständige Entwicklung lässt. Und schon mit der ersten gemeinsamen Nacht nach einem Opern-Besuch beginnt eine Geschichte des Abschiednehmens, in der Jimmy an der Uni zum wissenschaftlichen Mitarbeiter des extrovertierten Literaturprofessors Donelli wird, später als PR-Berater einer Firma aus Unterhaching fungiert und homosexuelle Kontakte mit dem Krankenpfleger Elvir eingeht. Doch auch in seiner Jugo-Community wird er zum Außenseiter, weil er den kroatischen Nationalismus nicht gutheißt. Er arbeitet schließlich tatsächlich Landschaftsgärtner, zum Beispiel auf dem Grundstück der Familie Gruber, wo er erfährt, dass Martha ein todgeweihter Pflegefall ist.
Der Roman endet bei einem auf den ersten Blick harmonischen Grillen der Großfamilie Kovacevic mit gehisster Deutschland-Fahne, im Hintergrund sieht und hört man aber die Großfackel der Firma BASF.
Die Mischung aus Coming-of-Age, Migrationsgeschichte, Gesellschaftskritik und Beziehungsdrama macht den Roman zu einem vielschichtigen und nie klischeehaften Text, in dem der auch als Lektor arbeitende Martin Kordić seine sprachliche Souveränität eindrücklich unter Beweis stellt. Eindeutige Lese-Empfehlung!
https://www.fischerverlage.de/buch/martin-kordic-jahre-mit-martha-9783596709366
PS.: eine Bühnenfassung des Romans wird derzeit am Staatstheater Nürnberg gespielt
https://www.staatstheater-nuernberg.de/spielplan-23-24/jahre-mit-martha/13-01-2024/1930

Christoph Peters: Krähen im Park (Roman) ****
Luchterhand (München 2023)
ca. 320 Seiten, 24.00 Euro
Wolfgang Koeppen: Tauben im Gras (Roman) ****
Suhrkamp (Frankfurt/Main 2015, 44. Auflage)
Erstausgabe: Scherz und Goverts Verlag (Stuttgart/Hamburg 1951)
ca. 230 Seiten, 8,00 Euro (Tb)
In der Kino-Branche ist ein Remake die Neuverfilmung eines schon einmal verfilmten Stoffes. Unter dem Begriff „Stoff“ lassen sich Drehbücher, Romane, Legenden oder historische Ereignisse subsummieren; nicht zu definieren ist, wie groß die Parallelität zwischen alter und neuer Fassung sein kann/muss. Der Schriftsteller Christoph Peters hat sich nun zu einem ambitionierten literarischen Remake-Projekt entschlossen: er will Wolfgang Koeppens „Trilogie des Scheiterns“ aus der Nachkriegszeit in die Gegenwart verpflanzen. So wurde schon aus „Das Treibhaus“ (1953) „Der Sandkasten“, nun mutieren die „Tauben im Gras“ (1951) zu „Krähen im Park“. In beiden Fällen notiert Peters in einer Vorbemerkung, dass Koeppens Romane im Hintergrund eine Rolle gespielt hätten. Das ist allerdings eine Untertreibung, denn Peters bezieht sich ziemlich genau auf Koeppens erzählerischen Aufbau, schafft zahlreiche Parallelen, was das Personal betrifft, und versucht sich auch in stilistischen Annäherungen (z. B. der Montage von Zeitungs-Schlagzeilen in den Prosa-Text).
Koeppens „Tauben im Gras“ spielt an einem Tag in den Jahren 1949 bis 1951: „Deutschland war in zwei Teile gebrochen“, es herrschte eine „Atempause auf dem Schlachtfeld, doch schon wieder wurde gerüstet, die Schlagzeilen der Zeitungen benutzen die Substantive SPANNUNG, KONFLIKT, VERSCHÄRFUNG und BEDROHUNG. Ort der Handlung ist eine Großstadt in der (ehemaligen?) amerikanischen Besatzungszone, vermutlich München. In diesem Setting werden die Schicksale von etwa 30 Protagonisten (es gibt keine eindeutige Hauptperson!) in Short Cuts vorgeführt, deren Lebenslinien sich an diesem Tag teilweise überschneiden. Der Roman endet mit dem Mitternachts-Läuten von einem Turm und den ersten Druckausgaben der Morgenblätter.

Bei Peters konzentriert sich die multiperspektivische Handlung auf den 9. November 2021, mitten im Höhepunkt der Corona-Krise in der Hauptstadt Berlin. Frische Schlagzeilen kommen jetzt im Minutentakt, sie sorgen für den „Suchtstoff Information“ und garnieren ihn mit dem „Brandbeschleuniger Meinung“. Genau wie Koeppen postuliert Peters, sein Text sei kein Schlüsselroman, Ähnlichkeiten mit Personen und Geschehnissen des Lebens seien Zufall und vom Verfasser nicht beabsichtigt. Das ist aber nicht konsequent durchgehalten, denn hinter dem Schriftsteller Bernard Entremont erkennt man unschwer Michel Houellebecq, Professor Bernburger (schon bekannt aus dem „Sandkasten“) ist eine bewusste Kopie von Karl Lauterbach, Professor Garbsen von der Charité erinnert stark an Christian Drosten - „Priester und Popstar“ - und die Literaturkritikerin Roswitha Pichler ist eine Wiedergängerin von Sigrid Löffler.
Bei Koeppen kommen zwei farbige US-Soldaten vor (Odysseus Cotton und Washington Price), die zeittypisch ungeniert als „Neger“ oder gar als „Nigger“ tituliert werden. Diese Verwendung des N-Wortes hat für Probleme bei der Verwendung von Koeppens Roman als (verpflichtende) Schullektüre gesorgt; bei Peters werden die beiden Figuren zu dem türkischen Paketzusteller Emre und dem afghanischen Flüchtling Ali Zayed.
Peters greift auch viele inhaltliche Motive der Vorlage auf: die Schwangerschaft einer 18jährigen und die Möglichkeit einer Abtreibung, die Schreibblockade eines erfolgreichen Schriftstellers, die chaotische Ehrung eines ausländischen Autors inklusive Fangemeinde, gescheiterte oder zerbrechende Beziehungen und der ungeklärte Todesfall einer Randperson.
Es lohnt sich, die beiden Werke parallel zu lesen: man erkennt die Entwicklung von moderner avantgardistischer Erzählung der Nachkriegszeit zu postmoderner Stilistik des 21. Jahrhunderts, von kulturkritischer Klage und Diagnose zu Ironie und Social-Media-Kritik. Marcel Reich-
Ranicki, der bei „Krähen im Park“ in einer sehr kleinen Nebenrolle unter dem Namen Wenzel Sturm-Moskovici auftaucht, bezeichnete Koeppens Text als „künstlerisch besten Roman dieser Zeit und dieser Generation“, dieses große Lob wird sich Christian Peters als letztlich doch epigonaler Nachschreiber literaturgeschichtlich nicht verdienen können. Immerhin hat er aber schon 2018 in Greifswald den Wolfgang-Koeppen-Literaturpreis gewonnen. Und nun warten wir gespannnt auf sein Remake von "Tod in Rom"!
https://www.penguin.de/Buch/Kraehen-im-Park/Christoph-Peters/Luchterhand-Literaturverlag/e617515.rhd
https://www.christoph-peters.net/
https://www.suhrkamp.de/buch/wolfgang-koeppen-tauben-im-gras-t-9783518371015

Simon Urban: Plan D (Roman) ***
Kampa Pocket (Frankfurt/Main 2023)
ca. 550 Seiten, 16,00 Euro
Originalausgabe: Schöffling & Co. (Frankfurt/Main 2011)
Wer im Zusammenhang mit Juli Zeh auf den Namen Simon Urban gestoßen ist und dessen hintergründig-unterhaltsamen Roman „Wie alles begann und wer dabei umkam“ gelesen hat, möchte auch noch weiter zu den Anfängen dieses Autors vorstoßen. Sein Roman-Debüt trug den Titel „Plan D“ und war - Achtung! - ein Krimi, jedoch zum Glück keiner dieser inflationär produzierten Regional-Krimis, sondern ein Polit-Krimi auf der Basis einer Polit-Fiction. Hintergrund ist nämlich die zeitgeschichtliche Konstruktion, dass es im Jahr 2011 noch (oder wieder) zwei deutsche Staaten gibt mit Egon Krenz an der Spitze der DDR und Oskar Lafontaine als Kanzler der BRD - also eine quasi-kooperative Zweistaaten-Lösung, die der DDR Zeit gibt, sich dem demokratischen Sozialismus zuzuwenden.
Dann aber rückt ein Toter in den Mittelpunkt: ca. 80 Jahre alt, an einer überirdischen Erdgas-Pipeline, die russisches Erdgas über die DDR nach Westdeutschland transportiert, erhängt. Und weil der Fall die Zusammenarbeit zwischen DDR und BRD beschädigen könnte, ermitteln zwei Kriminaler aus den beiden Staaten: der Ossi Martin Wegener aus Köpenick und der Sonderermittler Brendel aus Westberlin. Bald stellt sich heraus, dass der Tote ein früher vom Westen in die DDR geflüchteter Wissenschaftler namens Hofmann ist, der als Vertreter des sogenannten Posteritatismus eine Mischform aus Sozialismus und Demokratie (= Plan D) entwickeln und dazu mit Gregor Gysi eine Revolution gegen Egon Krenz anzetteln will. Als Täter kommen ehemalige Stasi-Mitarbeiter, oder eine obskure Bürger-Brigade oder gar ein westdeutscher Greentec-Konzern in Frage.
Ab diesem Moment wird die Geschichte zu einem manchmal verwirrenden Whodunit-Durcheinander, in das auch noch Dietmar Dath, Margot Honecker, Christa Wolf, Luc Jochimsen, Peter Sodann und Sahra Wagenknecht eingebaut sind. Doppel-Spionage, eine rächende Tochter und die Suche nach einer Zeitkapsel (mit entlarvenden Dokumenten) des Wissenschaftlers erweisen sich als nur begrenzt spannungsförderndes Füllmaterial. Eine richtige Auflösung findet nicht statt, Wegener wird stattdessen am Tatort verprügelt und gefesselt - und pinkelt sich vor Schreck in die Hose „als wäre nie irgendetwas passiert“.
Der von Juli Zeh geförderte Simon Urban hat also damals schon viel gewollt, jedoch noch nicht über die erzählerischen Mittel zur treffenden Umsetzung verfügt.

Michael Stavaric: Das Phantom (Roman) ***
Luchterhand (München 2023)
ca. 320 Seiten, 24,00 Euro
Der in der Tschechoslowakei geborene und nun in Wien lebende Autor Michael Stavaric ist offensichtlich eine großer Thomas-Bernhard-Fan und hat für seinen aktuellen Roman entschieden, den inneren Monolog einer männlichen Figur namens Thom (!) zum Thema zu machen. Ist das eine Hommage, eine Persiflage oder gar kulturelle Aneignung? Egal, jedenfalls reflektiert die Hauptperson, die unübersehbar die Bernhardsche Grundstimmung aus Misanthropie, Weltschmerz, Gesellschaftsverachtung und Lebenszweifel verinnerlicht hat, in zehn Kapiteln über ein Leben, das alles in allem erscheint „wie ein Totsein, ohne die eigentlichen Vorzüge eines solchen genießen zu dürfen“.
Jedes Kapitel beginnt mit der quasi-lexikalischen Definition eines Substantivs, das seinerseits auch Titel eines früheren Bernhard-Romans sein könnte: Eingebung, Verdüsterung, Verstörung, Verunmöglichung, Heimsuchung, Bevormundung, Bestechung, Auslöschung, Verinnerlichung und Abtötung. Dies geht einher mit der Beschreibung eines dauerhaft vorhandenen ekligen, klebrigen Gefühls im Mund („wie zerquetschte Insekten auf einer Windschutzscheibe“).
Thom sucht nach Ursachen in Vergangenheit (Kindheit) und Situationen in der Gegenwart (Erwachsensein) und kommt zu der Erkenntnis, auf ganzer Linie versagt zu haben, genauso wie die Eltern und die Gesellschaft insgesamt. Er ist der klassische Außenseiter, dessen Beziehungen zu Frauen systematisch scheitern und der langsam in einer Todesspirale aus Melancholie, Depression und Wutausbrüchen versinkt. Der Aufenthalt auf diesem Planeten wird für ihn zu einer Art „lebenslänglicher Haftstrafe“, zu einem „fürchterlichen Missverständnis“: „die Welt bleibt ein finsterer Ort … auf ewig von widernatürlichen, zerstörten und vernichtenden Menschen bevölkert“. Gute Überschrift für einen Jahresrückblick 2023?
Da auch die Zuwendung zu einem Haustier (bezeichnenderweise eine Schwarze Mamba!) keine Freude bringt, bleibt eigentlich nur der Selbstmord, der aber wegen Erschöpfungsüberfrachtung (noch) nicht stattfindet.
Über dieser originellen Lektüre schwebt aber immer der Zweifel, ob der Autor hier nur eine ausgefeilte Stilprobe vorlegen oder einen tatsächlichen Befund transportieren wollte. Der Text eignet sich allemal als Weihnachts- oder Silvester-Ansprache für bekennende Zyniker, Menschen mit diagnostizierter Depressivität sollten besser die Finger davon lassen!
https://www.penguin.de/Buch/Das-Phantom/Michael-Stavaric/Luchterhand-Literaturverlag/e589260.rhd

Ann Kathrin Ast: Beat (Roman) ****
Verlag Freies Geistesleben / Oktaven (Stuttgart 2023)
ca. 230 Seiten, 24,00 Euro
Patrick Süskind hat vor gut vierzig Jahren dem frustrierten Kontrabassisten ein theatralisches Denkmal gesetzt. Seitdem ist das Monodrama „Der Kontrabass“ ein beliebtes Repertoirestück (derzeit auch mit Sacha Tuxhorn in den Nürnberger Kammerspielen). Die Stuttgarterin Ann Kathrin Ast hat nun mit ihrem Debütroman „Beat“ eine andere Personengruppe im Orchester beleuchtet: den Schlagzeuger. Ihr Protagonist trägt den (Schweizer) Vornamen Beat, den man aber auch - für einen Rhythmiker höchst passend - bi:t aussprechen kann. Er ist ein vielversprechendes Talent an der Musikhochschule Mannheim, wird im Laufe des Romans aber immer mehr zu einer tragischen Figur, die von Selbstzweifeln und Zerbrechlichkeit geprägt ist.
Wir haben Christian Stier, langjähriges Mitglied der Staatsphilharmonie Nürnberg, derzeit in der Funktion des Solopaukers, als Experten gebeten, diesen Roman zu lesen und ein paar Fragen zu beantworten.
Hat es Sie überrascht, dass man über einen Schlagzeuger im klassischen Musikbetrieb einen Roman schreiben kann?
Ganz und gar nicht. Die Pauken-/Schlagzeuggruppe ist im klassischen Orchester eine Instrumentengruppe wie jede andere auch.
Die Autorin Ann Kathrin Ast hat ein Violoncello-Studium erfolgreich absolviert. Für ihr Thema ist sie also fachlich ausreichend kompetent?
In der Basis auf jeden Fall. Fächer wie z.B. Musiktheorie, Nebeninstrument, Hochschulorchester sind ja für alle Instrumentengattungen im Studium gleich. Allerdings hat sie sich mit Sicherheit für ein paar instrumentenspezifische Erläuterungen Rat und Informationen von Schlagzeugern geholt.

Der junge Mann hat große Begabung und große Hoffnungen. Wie schätzen sie die Chancen für junge Nachwuchsmusiker derzeit ein?
Die Aussicht auf eine feste Anstellung in einem deutschen Orchester ist alles andere als einfach. Die Zahl der jährlichen Absolventen ist im Vergleich zu den vakanten Positionen doch recht hoch. Dazu kommen heutzutage noch viele internationale Bewerbungen und letztlich geht es dann bei ca. 100 Bewerbungen um 20 Einladungen zu einem Probespiel um eine vakante Stelle.
Beat attackiert in dem Roman seine Mitstudenten: sie seien unpolitisch. Er sagt einmal wörtlich: „Wir verdummen alle für die Musik“. Ist diese Selbstkritik berechtigt?
Das ist im Orchesteralltag natürlich auch immer präsent. Wir sind ein großer Theaterbetrieb und da ist Politik unerlässlich. Wenn ich aber an meinen Pauken sitze, möchte ich frei und unpolitisch musizieren können.
Bei Beat treten immer wieder Wahrnehmungsstörungen bei höchster Anspannung in Prüfungs- oder Wettbewerbs-Situationen auf. Wie kann man sich davor schützen?
Das ist in der Tat ein wichtiges Thema. Um bei einem Probespiel oder Konzert möglichst 100% seiner Leistung abzurufen, bedarf es einer großen mentalen Stärke. Im Gegensatz zu meiner Studienzeit werden heute an den Musikhochschulen teilweise Wahlfächer für mentales Training, Probespielauftritt oder Bühnenpräsenz angeboten. Allerdings wäre es meiner Meinung nach wichtig, dies zu intensivieren.
Beat studiert klassisches Schlagzeug, lässt sich aber auch für ein Playback bei einer TV-Show engagieren. Wie fällt bei einem jungen Menschen die Entscheidung zwischen Rock-Schlagzeuger und klassischem Schlagzeuger?
Mein Vater war schon klassischer Schlagzeuger und ich habe quasi familiär bedingt direkt diese Richtung eingeschlagen. Jugendliche begeistern sich meist erstmal für das Drum-Set und wechseln dann bei Interesse später in den klassischen Bereich.
Beat nennt an einer Stelle Martin Grubinger als großes Vorbild. Dieser hat nun mit 40 Jahren seine Solo-Karriere beendet. Wie physisch und psychisch fordernd ist so eine künstlerische Tätigkeit?
Grubinger ist natürlich ein Ausnahmeschlagzeuger. Nach über 20 Jahren Vollgas ist es wohl eine weise Entscheidung, mal einen Gang zurückzuschalten. Ich persönlich komme nach über 40 Jahren Orchesterspiel mit dem psychischen Druck zurecht, physisch stoße ich mittlerweile auch an meine Grenzen.
Die Autorin Ann Kathrin Ast hat gesagt, der Roman sei eine Art Liebesgeschichte zwischen einem Musiker und der Musik. Kann eine solche Liebe auch erkalten?
Das wäre sehr schade.
Gegen Ende des Romans heißt es über Beat: „er kann hören, was er sieht, und er sieht, was er hört“. Ist diese Form der Synästhesie für professionelle Musiker naheliegend?
Wenn ich eine mir bekannte Partitur aufschlage, höre ich sofort die Musik - wenn ich die Musik höre, sehe ich oft die Noten vor mir. Bei Werken wie „Karneval der Tiere“ oder „Die Moldau“ erzählt uns der Komponist ja auch von der Tierwelt oder einer Landschaft. Insofern kann ich diese doppelte Sinneswahrnehmung nachvollziehen.
Gibt es Vorurteile über einzelne Musikergruppen in der Staatsphilharmonie?
Eine gewisse Außenseiterrolle kann man der Pauken-/Schlagzeuggruppe im positiven Sinne ruhig zugestehen. Ein Vorurteil ist das aber nicht.
Würden Sie den Roman ihren KollegInnen weiterempfehlen?
Als Insider schlüpfen wir da ja schnell in die Rolle des Protagonisten, mich würde die Meinung der allgemeinen Leserschaft mehr interessieren.
https://www.geistesleben.de/Buecher-die-mitwachsen/Oktaven-Belletristik-Biografie-Essay/Beat.html

Hanna Bervoets: Dieser Beitrag wurde entfernt (Roman) ***
Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten
Hanser Berlin (2022)
ca. 110 Seiten, 20,00 Euro
Jetzt gibt es also schon zwei Romane, die sich mit den un-sozialen Medien des 21. Jahrhunderts beschäftigen. Jene ziemlich kontrollfreien Kommunikations-Plattformen sind mittlerweile zu einem Tummelplatz für Gewaltverherrlichung, Verschwörungstheorien, Fake News und sexuelle Abartigkeiten geworden. 2018 machte Michael Hvorecky einen Blick in die Maschinenräume der osteuropäischen Troll-Fabriken („Troll“), jetzt legt die Niederländerin Hanna Bervoets einen Roman vor, der eine Gruppe von Content-Moderatoren beleuchtet, die für einen Dienstleister jeden Tag Hunderte von Beiträgen prüfen und gegebenenfalls löschen sollen. Kayleigh (nicht zu verwechseln mit der Titelfigur des gleichnamigen Songs von Marillion) ist die Ich-Erzählerin, und es geht um die Frage, was diese harte Arbeit mit Menschen macht und ob es nicht an der Zeit wäre, dafür Schmerzensgeld zu verlangen.
Zunächst beantworten Kayleigh, Robert, Kyo, Sigrid, Souhaim und Louis die Herausforderung ihres Jobs mit Abstumpfung: „Unsere Arbeit war völliger Shit, aber wir lassen uns nicht unterkriegen“. Bald aber werden einzelne durch Verschwörungstheorien selbst angefixt, andere retten sich in blanken Zynismus, wieder andere sehen nur eine Kündigung und eine arbeitsrechtliche Klage als Lösung: „Ich halte es bei Hexa nicht mehr aus … ich fühle mich einfach nicht mehr wie ein Mensch“.
Ob es dem Thema dient, dass eine komplizierte lesbische Beziehungsgeschichte zwischen Kayleigh und Sigrid eingewebt ist, mag jeder Leser selbst beurteilen; möglicherweise wäre sonst der Roman wirklich zu kurz geraten. Im Nachwort verweist Hanna Bervoets noch auf ihr Recherche-Material, d.h. auf wissenschaftliche und journalistische Studien zu dem Sachgebiet.
Aus beiden Romanen ergibt sich die Notwendigkeit einer rechtlichen Regelung für diese Grauzone; das Internet als rechtsfreier Raum wäre eine fatale Fortsetzung der Informations-Verdreckung, die mit dem privaten Fernsehen begonnen hat.
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/dieser-beitrag-wurde-entfernt/978-3-446-27379-5/
https://www.klett-cotta.de/produkt/michal-hvorecky-troll-9783608504118-t-2888

Ein sterbender Mann
Zum Tod von Martin Walser
Wenn die Frage gestellt wird, wer die über 75 vergangenen und kriegsfreien Jahre in Deutschland kritisch begleitet und literarisch verarbeitet hat, wird man an dem Namen Martin Walser nicht vorbeikommen. Denn egal, welche Schublade der Neueren Deutschen Literaturgeschichte geöffnet wird - Nachkriegsliteratur, Politisierung der Literatur, Neue Subjektivität, Postmoderne -, immer kann man ein paar Bücher von Martin Walser darin finden.
Der Beobachter vom Bodensee hat aus dem Südwesten der Republik seinen wachen Blick - beschirmt von den markanten Augenbrauen - auf das Land geworfen und die eigenen Irrungen und Wirrungen mit den guten und schlechten Entwicklungen der Gesellschaft und der Politik in Beziehung gesetzt. Walser (geboren am 24. März 1927) startete als Kafka-Epigone, entwickelte sich zum sprachmächtigen Gesellschaftsanalytiker und -kritiker und zum agent provocateur gegen die political correctness, mittlerweile darf er als altersmilder, aber nimmermüder elder statesman der deutschsprachigen Literatur regelmäßige Statusmeldungen abgeben.
Es war im Sommer 1975, als ich ein Hauptseminar der Universität Erlangen zum Thema Martin Walser besuchte und erstmals realisierte, dass das Germanistik-Studium nicht nur aus Literaturtheorie und Sprachwissenschaft, sondern auch aus praktischer reflektierter Lektüre besteht. Die Romane von „Ehen in Philippsburg“ bis zu der voluminösen Anselm-Kristlein-Trilogie verrieten mehr über die Gesellschaft der Bundesrepublik als manches dröge Soziologie-Seminar. Ein Jahr später besuchte ich eine Lesung des Autors in Nürnberg, bei der es zu einem heftigen Schlagabtausch mit Hans-Bertram Bock, dem damaligen Feuilleton-Chef der Nürnberg Nachrichten, kam. Bock hatte es gewagt, Walser auf die Fragwürdigkeit seines DKP-Sympathisantentums hinzuweisen, was dieser mit einer dünnhäutigen Retourkutsche über die westdeutsche Literaturkritik beantwortete.
Angesichts dieser kleinen Szene war es nicht verwunderlich, dass Walser sich den Literatur-Papst Marcel Reich-Ranicki zum Lieblingsgegner erkor. Dieser hatte 1976 in gewohnt selbstherrlicher Weise über den Roman „Jenseits der Liebe“ geschrieben: „Ein belangloser, ein schlechter, ein miserabler Roman. Es lohnt sich nicht, auch nur ein Kapitel, auch nur eine einzige Seite dieses Buches zu lesen.“ Dem setzte Martin Walser 26 Jahre später in dem Schlüsselroman „Der Tod eines Kritikers“ die Figur des Literaturkritikers André Ehrl-König entgegen - unschwer als Reich-Ranicki zu erkennen -, der auf mysteriöse Weise ums Leben kommt und als machtbesessener „Großkaspar“ charakterisiert wird.
All dies hinderte jedoch Walser nicht daran, mit der Novelle „Ein fliehendes Pferd“ 1978 zum Bestseller-Autor zu werden. Tausende von Deutschlehrern sahen in der Midlife-Crisis des „Kollegen“ Helmut Halm ihre eigenen Probleme trefflich gespiegelt und nötigten ihre Schüler zur Klassen-Lektüre. Die Verfilmung mit dem herrlich griesgrämigen Ulrich Noethen und dem Gegenmodell Ulrich Tukur als Klaus Buch tat ein Übriges.

Dass Martin Walser - ganz im Gegensatz zu seiner Tochter Theresia - mit der literarischen Gattung Drama nie richtig warm wurde (und übrigens auch umgekehrt die Schauspieldirektoren nicht mit seinen Bühnenstücken), belegt ein Beispiel aus Nürnberg: 1973 fragte Burkhard Maurer, damals der Dramaturg des Opernhauses, bei Walser nach, ob er nicht für ein „Musical“ über den Liedermacher Jörg Graf eine Textfassung schreiben wolle. Walser wollte und begann dann mit Recherchen zu dem historischen Umfeld - auch im Nürnberger Stadtarchiv. Daraus wurde „Das Sauspiel. Szenen aus dem 16. Jahrhundert“. Doch die Uraufführung in Nürnberg scheiterte an den Gagenforderungen des Komponisten Mikis Theodorakis, stattdessen kam es 1975 zu einer Premiere am Hamburger Schauspielhaus. Die Reaktion der Theaterkritiker fiel sehr zurückhaltend aus: Benjamin Henrichs bemerkte in der ZEIT, dass Walser eben „nur ein dürftiger Figurenerfinder und Dialogschreiber“ sei.
In Nürnberg blieb es bis heute bei gerade mal einer Bühnen-Begegnung mit Walser: sein Zweiakter „Die Zimmerschlacht“ wurde 1969 in den Kammerspielen aufgeführt. Daraus hätte ein veritabler Dauerbrenner werden können. Denn das Ehepaar Trude und Felix (in Nürnberg verkörpert durch Ursula Burg und Karl-Heinz Wüpper) führt hier ein echt göttliches Gemetzel vor - frei nach dem Motto „Wer hat Angst vor dem Alter?“
Poltischen Debatten ging der störrische Autor, der seinen Hauptpersonen gern den Nachnamen Zürn (!) gab, nicht aus dem Weg, sodass ihn Peter Glotz einmal als „wütigen Heimatdichter“ abstrafte und Günter Gaus böse anmerkte, seine Gefühlswelt sei „reicher ausgestattet als sein Intellekt“. Nach einer frühen DKP-Annäherung entwickelte er ab den 1980er Jahren bürgerlich-konservative Wertvorstellungen und vor allem die unbändige Lust, gegen Denkverbote des Kulturbetriebs anzuschreiben. Schon 1977 äußerte er eine „Sehnsucht nach der Wiedervereinigung“ und stellte zehn Jahre später fest, die Nation sei im Menschenmaß „das mächtigste geschichtliche Vorkommen“. Ein medialer Aufschrei begleitete seine Paulskirchenrede 1998 anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Walser sprach von Zweifeln an der deutschen Gedächtnis- und Bewältigungskultur, warnte vor Ausschwitz als „Moralkeule“ und nannte das Holocaust-Mahnmal einen fußballfeldgroßen Albtraum im Herzen der Hauptstadt. Deshalb wird er seitdem in der Longlist einiger AutorInnen gesehen, die sich - so ihre Kritiker - im politischen Raum verrannt hätten: ähnlich wie Peter Handke, Monika Maron, Daniel Kehlmann oder Uwe Tellkamp.
Ruhiger verliefen die letzten etwa fünfzehn Jahr für den kontinuierlich publizierenden Schriftsteller, der 2017 seinen 90. Geburtstag feierte. Dies tat er mit einer leicht verrätselten Selbstbespiegelung unter dem Titel „Statt etwas oder Der letzte Rank“. Das Nürnberger Literaturhaus war jedenfalls ausverkauft, als er diesen „Roman“ vorstellte. Im Jahr darauf musste er wegen eines grippalen Infekts absagen. Seine letzte Veröffentlichung ist anhand einer alten Entwurfsskizze aus dem Jahr 1961 entstanden: die Legende „Mädchenliebe oder Die Heiligsprechung“. Darin erzählt Anton Schweiger (schon wieder ein Deutschlehrer!) von der jungen Sirte Zürn („ein Mädchen … wie kein anderes“), die Wunder bewirkt und von ihrem Vater zur Seligsprechung vorgeschlagen wird. Auf eine Selig- bzw. Heiligsprechung oder auf einen Literatur-Nobelpreis braucht Martin Walser nicht mehr zu hoffen, aber eine Tagebuchnotiz dieser „schönen Verschwiegenen“ mag als Motto für sein Lebenswerk stehen: „Meine Sätze sind Seile über Abgründen“.

Finn-Ole Heinrich: Räuberhände (Roman) ***
Ernst Klett Sprachen (Stuttgart 2018)
Originalausgabe: Mairisch Verlag (Hamburg 2007)
ca. 200 Seiten, 8,75 Euro
Das ist auf jeden Fall ein Hardcore-Jugendroman, der ein wichtiges Thema anpeilt, dabei aber nicht vor Vulgärsprache zurückschreckt. Es geht um die Freundschaft zweier Jugendlicher, die gerade ihr Abitur absolviert haben. Die sozialen Rahmenbedingungen auf diesem Bildungsweg waren jedoch höchst unterschiedlich.
Während Janik, der Ich-Erzähler, in einem wohlbehüteten Haushalt aufwächst - beide Eltern sind Gymnasiallehrer -, hat Samuel eine alkoholkranke Mutter (Irene), die zunehmend in die Penner- und Obdachlosenszene abdriftet. Über seinen verschwundenen Vater weiß er nur, dass es ein Türke namens Osman war, der die Familie bald wieder verlassen hat und in die Türkei zurückgekehrt ist. Das Abitur hat er aber dennoch geschafft, weil er von Janiks Eltern quasi als Adoptivsohn behandelt worden ist und zusammen mit Janik in deren Gartenlaube gelernt hat. Ihm gehören auch die titelgebenden „Räuberhände“: abgekaute Nägel, blutig gebissene Haut.
Der Sündenfall, der die Freundschaft der beiden Jungs massiv belastet, passiert auf einem Straßenfest kurz vor dem Abitur. Janik lässt sich auf einen Tanz mit der heruntergekommenen Irene ein, es kommt zu Sex hinter einem Toilettenwagen, den Samuel sogar beobachtet: „Du bist pervers“.
Fast wie eine Entschuldigung wirkt darauf Janiks Bereitschaft, mit Samuel nach dem Abitur nach Istanbul zu reisen. Dieser will dort seinen Vater suchen und sich eine eigene Existenz aufbauen. Die neue Familienzusammenstellung scheitert aber auf der ganzen Linie, weil es vom Vater keinerlei gesicherte Aufenthaltsorte gibt und weil die Mutter zu Hause in Deutschland an einem Schädelbasisbruch stirbt. Für Samuel eigentlich kein trauriges Ereignis: „Eltern sollen sterben, wenn man erwachsen wird, damit man überhaupt Platz genug hat, um erwachsen zu werden“. Schon vorher hat er sein Coming-of-Age-Prinzip so artikuliert: „Eltern müssen egal sein, man muss sie vergessen, vergaben … oder man wird ewig ihr Kind bleiben“. Warum aber dann die intensive Suche nach dem Vater?
Für Janik ist Istanbul verständlicherweise keine Perspektive, er verabschiedet sich von Samuel und fliegt nach einer gemeinsamen Flasche Raki wieder zurück nach Deutschland, um dort zu studieren oder rumzuhängen oder zu jobben. Von Samuel hat er offensichtlich etwas gelernt: „Vielleicht läuft darauf das Erwachsenwerden hinaus, … die Kunst im besten Falle, einfach klarzukommen … notwendig, dass die großen Regungen von einem abfallen“. Doch nicht oft kommunizieren die beiden derart reflektiert, oft bleibt es beim vulgären Jugend-Slang, der die Leserschaft (ab 16?) möglicherweise polarisieren wird.
Heinrich hat das Geschehen auf 20 Kapitel mit unterschiedlichen Zeitebenen verteilt, jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen, etwa vierzeiligen Kopf-Passage, in der das Ausräumen von Irenes Wohnung mit Bildern einer besseren Vergangenheit gezeigt wird. 2020 gab es eine Verfilmung des Romans von Ilker Catak, die aber weniger Aufsehen als die Erstausgabe 2007 erregte. Eine Bühnenfassung in der Regie von Anne Lenk (Uraufführung 2013) läuft (immer) noch am Thalia-Theater Hamburg.
https://www.finnoleheinrich.de/
https://www.thalia-theater.de/stueck/raeuberhaende-2013
https://www.klett-sprachen.de/raeuberhaende/t-1/9783126667111

Sanne Jellings: Helenes Stimme (Roman) ***
Kindler / Rowohlt (Hamburg 2023)
ca. 205 Seiten, 20,00 Euro
Der 175. Geburtstag von Helene Lange hat heuer zumindest zwei ehrende Produktionen mit sich gebracht: zum einen präsentierte das Bundesfinanzministerium eine Sonderbriefmarke mit dem Wert von 1,95 Euro, auf der sie vor gelbem Hintergrund (passend zu ihrer „Gelben Broschüre“, 1887) abgebildet ist; zum anderen wagte sich die Autorin Sanne Jellings an eine Biografie - oder besser ausgedrückt: an eine biografische Doku-Fiction mit dem Titel „Helenes Stimme“. Für oberflächliche Beobachter sei hinzugefügt: es geht in dem Roman nicht um den deutschen Schlager-Superstar Helene Fischer, sondern um die Pionierin der deutschen Frauenbewegung, die atemlos für das Recht auf höhere Bildung für Frauen kämpfte und deren Name seit 1965 das Fürther Gymnasium in der Tannenstraße schmückt.
Sanne Jellings wollte bewusst keine traditionelle Lebensgeschichte schreiben; stattdessen hat sie zwei Zeiträume genauer beobachtet und Helene Lange mit einer anderen historisch verbürgten Frau, der Pfarrerstochter Marie Eifert aus dem schwäbischen Ehingen konfrontiert. Somit verfolgt man die Parallelgeschichte zweier exemplarischer Personen. Zunächst wie sie sich als junge Mädchen im Pfarrhaus der Familie Eifert treffen, an dem die 16jährige Vollwaise Helene Lange ein sogenanntes Pensionatsjahr verbrachte. In dieser pietistisch-konservativen Umgebung der Jahre 1864/65 reibt sich Helene schnell an dem Bibelspruch „ein Weib lerne in der Stille mit aller Untertänigkeit“ (1. Tim., 2), sie will auch von den gebildeten Männern, die im Pfarrhaus ein- und ausgehen, profitieren und statt Handarbeiten lieber ein Buch lesen. Das Schicksal einer verheirateten Frau mit fünf Kindern führt sie zu der Erkenntnis: „Eine Frau muss ihr eigenes Geld verdienen dürfen“. Und die tragische Entwicklung bei ihrer Freundin Marie (18), die beim Dorffest von einem Studenten geschwängert wird und zur Hochzeit gezwungen werden soll, lässt Helene weiterdenken: „Wenn man Mädchen zu einem Beruf ausbilden würde, der sie ernähren kann, wären sie nicht angewiesen darauf, geheiratet zu werden“. Im Zeichen einer massiven Glaubenskrise verlässt sie vorzeitig das Pfarrhaus.
Die zweite Zeitschiene beleuchtet die Jahre 1926 und 1927 in Berlin, wo Helene Lange vor ihrem Tod (1930) zusammen mit ihrer „Sekretärin“ Gertrud Bäumer weiterhin für die politische und soziale Gleichberechtigung der Frauen und für den Bildungsanspruch junger Mädchen kämpft. Sie bekommt eine Einladung an die Mädchen-Oberrealschule nach Hamburg, wo sie erstmals in Deutschland zur Namenspatronin gewählt wurde. In ihrer Festrede ermutigt sie die Schülerinnen: „Eine fundierte Ausbildung wird aus ihnen sittlich und geistig selbständige Persönlichkeiten machen“. Das bedauerliche Gegenbild ist die Jugendfreundin Marie, die mit einer psychischen Erkrankung in einer „Irrenanstalt“ endet.
Sanne Jellings ist es mit ihrem Erzählkonzept gelungen, eine brot-trockene Biografie zu vermeiden und sich auf Schlüsselerlebnisse einer berühmten Frau zu konzentrieren, dazu historische Ereignisse und private Erlebnisse geschickt zu kombinieren. Nicht nur als Klassenlektüre am Helene-Lange-Gymnasium in Fürth zu empfehlen!
https://www.rowohlt.de/buch/sanne-jellings-helenes-stimme-9783463000411
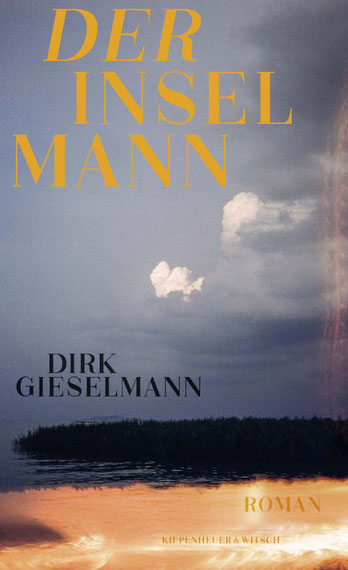
Dirk Gieselmann: Der Inselmann (Roman) ****
Kiepenheuer & Witsch (Köln 2023)
ca. 170 Seiten, 20,00 Euro
Mit einem Inselroman kann man Büchner-Preisträger werden: Lutz Seiler hat es vorgemacht („Kruso“). Bei Dirk Gieselmanns Debütroman geht es allerdings nicht um die Fluchtort-Insel Hiddensee, sondern um eine geografisch sehr undeutlich konnotierte Insel in einem See, der möglicherweise in der früheren DDR zu finden wäre. Auch zeitlich lässt sich das Geschehen nur vage bestimmen, einmal heißt es: Tausende Leute verließen das Land, „denn die Hoffnung war aus dem Land gewichen“ - reden wir also von der DDR nach oder kurz vor 1961?
Im Mittelpunkt der Handlung steht die kleine Familie Roleder (Vater Richard, Mutter und Sohn Hans). Der Vater glaubt, die Stadt verlassen und sich auf einer kleinen Insel in einem Schäferhof neu ansiedeln zu müssen. Für den zehnjährigen Hans ist die Insel ein Symbol der Freiheit, er sieht sich dort als Herrscher von Amerika: Hans, der freie Inselkönig!
Doch die Schulpflicht macht vor der Insel nicht Halt, Hans muss sich wieder in der Volksschule einfinden und jeden Tag mit dem Ruderboot den Freiraum verlassen. Als er sich verweigert, wird er in eine Besserungs- und Arbeitsanstalt für junge Menschen eingeliefert - man erinnert sich an Grit Poppes Roman „Weggesperrt“ (2009) über Schicksale von DDR-Jugendlichen in sogenannten Jugendwerkhöfen. Hans lässt sich jedoch durch das schwarz-pädagogische Motto „Platanen muss man stutzen, damit sie wachsen können“ nicht zerbrechen, wird aber zu Hans, dem Gezeichneten (Ähnlichkeiten mit Hans Giebenrath aus Hermann Hesses „Unterm Rad“ sind nicht zu verkennen). Mit 18 wird er freigelassen und darf wieder zurück auf seine Insel: Hans, der Heimkehrer. Dort findet er aber die Mutter nur noch als wirre Greisin und den Vater als Toten im Bett. Er bleibt nun bald allein auf der Insel und wird eins mit ihr: Hans, die Schauergestalt, der gefürchtete Inselmann (oder eine Fortschreibung von Storms „Schimmelreiter“): gibt es ihn noch, gab es ihn je? Gleichmäßig wie der Wellenschlag auf dem See geht auch sein Leben zu Ende: Hans, der Verblassende.
Gieselmanns kurzer Roman entwickelt aus dem Coming-of-Age-Schicksal des jungen Mannes eine zutiefst bedrückende Geschichte, die von sprachlicher Kraft und verrätselter Hermetik geprägt ist. Ob der Verfasser, der bislang nur durch Reportagen und ein Theaterstück aufgefallen ist, höhere literarische Aufmerksamkeit findet, bleibt abzuwarten. Als nächstes Werk ist jedenfalls die Beschreibung der musikalischen Sozialisation eines jungen Mannes durch die Songs der Grunge-Band Pearl Jam angekündigt.
https://www.kiwi-verlag.de/buch/dirk-gieselmann-der-inselmann-9783462000252

Simon Urban: Wie alles begann und wer dabei umkam (Roman) ****
Kiepenheuer & Witsch (Köln 2022)
ca. 540 Seiten, 14,00 Euro
Wer auf dem Weg über Juli Zehs aktuellem Bestseller „Zwischen Welten“ den Ko-Autor Simon Urban erstmals kennengelernt hat, sollte sich die Mühe machen, das bisherige literarische Schaffen des Herrn Urban einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Über das originelle Debüt „Plan D“ (2012), das der DDR eine überraschende Nachspielzeit zubilligte, und über den religionskritischen Roman „Gondwana“ (2014) gelangt man zu seinem rechtsphilosophischen Thriller „Wie alles begann und wer dabei umkam“ (2021), der wohl auch die ehrenamtliche Verfassungsrichterin Zeh von der Qualität dieses Autors überzeugte.
Schon im Voraus kann diese Qualität kurz beschrieben werden: Simon Urban schafft es, historisch-politische, ethische oder juristische Grundfragen mit einer spektakulären Story zu verknüpfen und damit die traditionelle Funktion der Kunst (docere et delectare) zu erfüllen.
„Wie alles begann“ erweist sich dabei als eine pralle Mischung aus Coming-of-Age-Roman, Campus-Roman, rechtsphilosophischem Diskurs und exotischem Abenteuer-Roman. Literarische Vorbilder wie das Kleistsche Michael-Kohlhaas-Motiv, Friedrich Dürrenmatts Groteske „Justiz“ und Bernhard Schlinks differenzierte Frage nach der Schuld („Der Vorleser“) schimmern behutsam durch die über 500 - niemals langweiligen - Seiten.
Im Mittelpunkt steht der „grandiose Unmensch“ J. Hartmann, dem Urban einen Vornamen verweigert und einen vielsagenden Nachnamen zugesprochen hat. Dieser Protagonist erlebt als Jugendlicher eine böse Großmutter, die das Leben der Mutter durch eine „familiäre deutsche Tyrannei“ zur Hölle macht. In seinem Tagebuch dokumentiert er einen fiktiven Prozess gegen die Großmutter, der mit einem Todesurteil endet! Damit ist auch sein tiefes Interesse am Strafrecht geweckt und ein Jurastudium (in Freiburg) vorprogrammiert. Als bienenfleißiger Student wird er schnell zum juristischen Querdenker (die meisten Kommilitonen bezeichnet er als „homogene Horde routinierter und kontrollierter Opportunisten“) und reibt sich besonders an der neuen Lehrstuhlinhaberin Dr. Meta Formella, die im rechtsphilosophischen Fahrwasser der defense sociale (= Abkehr vom Schuldstrafrecht) schwimmt. Hartmann - und mit ihm seine Freundin Sandra - driftet dagegen immer mehr in ein Konzept der legitimen Rache, weil er glaubt, ein Rechtsstaat mit Resozialisierungs-Ideal produziere viele ungesühnte Straftaten. Die praktische Umsetzung ihrer Sühne-Vorstellungen ist ein Besuch bei Sandras unbelehrbarem Großonkel Willi im Pflegeheim, wo Sandra (im Affekt?) den ehemaligen SS-Unterscharführer und Wachmann in Mauthausen mit dem Kopfkissen erstickt. Hartmann beendet seine juristische Karriere mit einer provokativen Stipendiums-Rede vor erlesenem Auditorium: anhand des fiktiven Falles einer Entführung und Ermordung eines neunjährigen Mädchens macht er sein Rache-Konzept öffentlich.
Mit einem knalligen Ortswechsel beginnt Urban den zweiten Teil des Romans. Hartmann ist nun in Papua-Neuguinea und studiert auf einem Thunfisch-Trawler unmenschliche Arbeitsbedingungen. Danach trifft er in Singapur einen gewissen Rufus Hundertmorgen, der von Hartmanns „Studium der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in Theorie und Praxis“ beeindruckt ist. Er erzählt ihm von dem Fall des Wong Lin Malevich, der dank seiner sexuellen Attraktivität fast 100 Frauen mit dem HIV-Virus angesteckt hat. Malevich wurde aber freigesprochen, weil er glaubhaft machen konnte, dass er von seiner Erkrankung gar nichts wusste. Danach hat er aber in einer Biografie sogar ein Geständnis abgelegt; wegen des Rechtsprinzips „ne bis in idem“ war aber eine erneute Verhandlung nicht mehr möglich! Deshalb organisieren Hartmann und Hundertmorgen einen privaten Schauprozess, der zum Todesurteil führt … und zu der Frage, ob Hartmann dieses Urteil im Sinne einer „gerechten“ Selbstjustiz auch exekutieren wolle.
Bei dem Erzähler Urban gibt es keine Zwischentöne, es wird geklotzt und nicht gekleckert, es geht eigentlich immer um Tod oder Leben. Das versetzt den Leser jedoch in eine ideale Pro-Contra-Situation und damit in einer Stimmung aus gespannter Aufmerksamkeit und reflexiver Nachdenklichkeit. Dass Urban auch - ganz im Stile eines Joseph von Westphalen - mit Ironie umgehen kann (etwa beim Besuch eines Heino-Konzerts) gibt dem Prosatext noch eine zusätzliche Nuance. Der Roman endet mit dem Verdikt der Professorin Formella, die mittlerweile Justizministerin in NRW geworden ist: „Sie haben das oberste Gebot für eine professionelle Beschäftigung mit dem Thema Jura nicht verstanden“. Diesen Vorwurf muss sich Simon Urban nicht zu eigen machen, denn er war ein Student der Germanistik und ist nun ein erfolgreicher Schriftsteller. Aus der Betrachtung von Extremen (Rache-Prinzip, Relativierung von Folter, einseitige Opferperspektive, Begründung der Selbstjustiz, Relativierung von Gut und Böse) kann manchmal eine vertiefte Erkenntnis wachsen!
https://www.kiwi-verlag.de/buch/simon-urban-wie-alles-begann-und-wer-dabei-umkam-9783462003574

Sarah Jäger: Die Nacht so groß wie wir (Roman) ***
Ernst Klett Sprachen (Stuttgart 2023)
Originalausgabe: Rowohlt (Hamburg 2021)
ca. 150 Seiten, 8,75 Euro
Fünf Freunde, aber nicht die von Enid Blyton mit detektivischem Spürsinn, sondern fünf Abiturienten, die am Tag der Zeugnisverleihung und in der Nacht der Abifeier mit der Vergangenheit abrechnen und Perspektiven für die Zukunft präzisieren wollen. Bastian, mit dem Spitznamen „Pavlow“, gibt die Parole aus: „Das ist die Nacht, in der wir sterben müssen. Vom Ungeheuer verschlungen und dann wiedergeboren“. Es wird dann aber eher die Nacht der Abrechnung, der Beziehungs-Verwirrungen, des heißen Stuhls und des unsicheren Wegs in eine neue Entwicklungsstufe.
Sarah Jäger hat in ihren modernen Coming-of-Age-Roman fasst alle genretypischen Konfliktlinien eingebaut, sodass es manchmal heftig scheppert und nicht nur verbaler Radikalismus zum Vorschein kommt. Es geht um die Auseinandersetzung mit den Eltern, um innere Streitigkeiten in der Peer Group, um sexuelle Erfahrungen und Identität, um die Frage nach der Legalität und Legitimität von Protest und um Neuorientierung nach dem Ende der (gymnasialen) Schullaufbahn.
Zwei Mädchen und drei Jungs stehen im Mittelpunkt des Geschehens:
- Maja, die stets rational denkende „Intelligenzkröte“, die „Johanna der Schulhöfe“, die sich aber auch manipulativ in Entscheidungsprozesse einmischt und damit den Wert der Gruppen-Demokratie in Frage stellt. Das könnte auch ihre ambitionierte Zukunftsplanung (Praktikum am Deutschen Kulturinstitut in Osaka) in Frage stellen.
- Suse, die am frühen Tod ihres Vaters zu knabbern hat, und nach Beziehungen zu Bo, Bastian und Nastja in ihrer sexuellen Orientierung noch unsicher ist.
- Bastian / „Pavlow“, der an diesem Abend ziemlich heftig mit seinem Vater abrechnet, der die Familie schon vor Jahren verlassen hat. Aus seinem früheren Referat über die Pavlowschen Hunde hat er die Lehre gezogen, man müsse Pavlow sein, nicht der Hund. Und so glaubt er auch, in der Beziehung zu Suse all in gehen zu müssen.
- Bo, der tendenzielle Loser in der Clique, denn er hat trotz eines Schulwechsels das Abitur nicht geschafft, außerdem muss er sich mit der Diagnose eines Aneurysmas im Hirn auseinandersetzen.
- Schließlich gibt es noch Tolga, den verschlossenen Nerd mit Kapuzenjacke, seit der 5. Klasse mit Maja befreundet. Weil er mit ihr im Wald eine geheimes Rückzugshütte mit dem Namen „Notausgang“ gebaut hat, traut er sich nicht, Majas Manipulation öffentlich zu machen.
Am Ende erweist sich der Zusammenhalt in der Clique als fragil: der Tag nach der Abiturfeier zeigt nur noch drei Personen in dem langjährigen Treffpunkt „Kneipe“.
Alle fünf Hauptperson haben ihre Kapitel, bei denen aus der jeweiligen Perspektive erzählt wird. So entsteht ein vielschichtiges Panorama einer Generation, die auf der Suche nach Identitäten ist, die aber auch mit David Bowies Song „Let’s Dance“ in die Verdrängung flüchtet.
Der Roman bemüht sich um eine authentische, nicht zu plakative Jugendsprache, er war für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 nominiert. Wer eine vergleichbare Situation von Jugendlichen (allerdings in den USA der 1960er Jahre) neben die Lektüre stellen will, sei auf George Lucas‘ Film „American Graffiti“ (1973 im Kino) verwiesen.
https://www.klett-sprachen.de/die-nacht-so-gross-wie-wir/t-10/9783126667159

Ewald Arenz: Der große Sommer (Roman) ***
Dumont (Köln 2021),
ca. 315 Seiten, 20,00 Euro
Was haben Ewald Arenz und Peter Maffay gemeinsam? Beide haben mit einer Sommergeschichte einen Hit gelandet. Bei Peter Maffay war es 1976 der Schlager „Und es war Sommer“ (geschrieben von Christian Heilburg und Joachim Heider), zur deutschen Nr. 1 avancierte, bei Ewald Arenz war es 2021 der Roman „Der große Sommer“, der den Fürther Autor in die Spiegel-Bestsellerliste katapultierte. Und wie es der Zufall so will, steht bei beiden Werken ein 16jähriger Jugendlicher als Ich-Erzähler im Mittelpunkt des Geschehens und hat ein einschneidendes Coming-of-age-Erlebnis.
Bei Maffay heißt es: „Ich war sechzehn und sie einunddreißig / Und über Liebe wusste ich nicht viel / Sie wusste alles / Und sie ließ mich spüren / Ich war kein Kind mehr / Und es war Sommer.“ Bei Arenz erlebt der 16jährige Friedrich Büchner mit der etwa gleichaltrigen Beate im Sommer 1981 die erste große Liebe, die aber bald auf eine ernste Probe gestellt wird. Während Maffay von einem Initiations-Erlebnis der Männlichkeit an irgendeinem Strand berichtet, ist bei Arenz der illegale nächtliche Besuch eines Freibades und der gemeinsame Sprung vom 7,50-Meter-Brett die Schlüsselstelle vor dem ersten Kuss: „Das war der wirkliche Anfang dieses verrückten Sommers“.
Damit sei es aber genug der Parallelen, denn es wäre ungerecht, Arenz‘ Roman auf eine Stufe mit den Trivial-Klischees des deutschen Schlagers zu stellen. Es passiert nämlich noch viel mehr in diesen sechs Wochen, die Frieder eigentlich für die Vorbereitung seiner Nachprüfung nutzen sollte, um doch noch in die 10.Klasse des Gymnasiums aufrücken zu dürfen. Die urlaubende Restfamilie hat ihn bei Oma und Opa geparkt, wo er - neben Latein und Mathe - viel fürs Leben lernen kann. In die Liebes-Wirrungen zu Beate mischen sich auch noch Frieders etwas ältere Schwester Alma und sein Schulfreund Johannes, der jedoch als unkonventioneller Querdenker am Ende der Ferien in der Psychiatrie landet. Und hier drängt sich schon wieder eine Parallele auf, denn Arenz‘ Junioren-Quartett erinnert in einigen Wesenszügen, in zahlreichen Problemfeldern und auch in den lakonischen Kommunikationsformen stark an die vier Gymnasiasten aus Bov Bjergs Roman „Auerhaus“ (der war übrigens Ende 2015 auch in der Spiegel-Bestsellerliste!). Aktuelle Coming-of-age-Romane bedienen doch immer wieder ähnliche Themen! Schade eigentlich in diesem Zusammenhang, dass die „Sommernovelle“ der aus Nürnberg stammenden Autorin Christiane Neudecker (2015) deutlich wenige Resonanz bei den Lesern gefunden hat.
Das Schlusswort übergeben wir unübersetzt an den amerikanischen Sänger Robert James Ritchie alias Kid Rock mit ein paar Zeilen aus seinem häufig im Radio gespielten Song „All Summer Long“ und damit einer weiteren Sommer-Rückerinnerung: „It was 1989 / my thoughts were short my hair was long / Caught somewhere between a boy and man / She was seventeen and she was far from in-between / It was summertime in Northern Michigan / … We didn't have no internet / But man I never will forget / The way the moonlight shined upon her hair“.
Alles in allem: Dieser Artikel präsentiert ein unterhaltsames und multimediales Sommer-Paket für den nächsten Freibad-Besuch oder Strand-Urlaub im August.
https://www.dumont-buchverlag.de/buch/arenz-der-grosse-sommer-9783832181536/

Klara Jahn: Das Lied des Waldes (Roman) **
Heyne Verlag (München, 2022)
383 Seiten, 22,00 Euro
Wer bin ich - und wenn ja wie viele? Diese Frage des Philosophen Richard David Precht kann die Schriftstellerin Julia Kröhn ziemlich eindeutig beantworten. Denn außer ihrem Klarnamen veröffentlicht sie Romane noch unter fünf weiteren Pseudonymen (z. B. Catherine Aurel, Carla Federico, Kiera Brennan oder Sophia Cronberg). Sie arbeitet damit in der Tradition der Lohnschreiber von Bastei-Groschenheften, die grundsätzlich nur mit einem dem Genre angepassten „Künstler“-Namen auf der Titelseite firmierten.
Als Klara Jahn veröffentlichte die gebürtige Ober-Österreicherin vor einem Jahr den frisch-fromm-fröhlich-freien und auch ein bisschen feministischen Roman „Das Lied des Waldes“, dessen Schauplatz der Reichswald rund um Nürnberg ist. Im Mittelpunkt der Parallel-Erzählung stehen zwei Frauen: die sehr gegenwärtige, aber fiktive Veronika und die 1364 geborene, historisch verbürgte Anna Stromer, Tochter des wohlhabenden Nürnberger Patriziers Ulmann Stromer. Die Verknüpfung der beiden Handlungsstränge in jeweils 12 Kapiteln erfolgt durch das Bildsymbol einer uralten Eiche und durch die auktoriale Konstruktion, dass Veronika schon als Schülerin ein Referat über Anna Stromer halten musste und in ihr auch später ein Vorbild sah.
Aus diesem Doppel-Porträt entsteht schließlich eine aspektreiche Kulturgeschichte des Waldes: vom esoterischen Waldbaden über Klangkunst-Experimente bis zur aktivistischen Baumhaus-Besetzung, von der ersten geplanten Wald-Saat in Deutschland (im heutigen Nürnberger Stadtteil Lichtenhof) bis zu Rodungs-Orgien für die Papier-Industrie, also praktisch ein historischer Aufriss vom spätmittelalterlichen Ur-Wald über den monokulturellen Steckalaswald bis zum Hambacher Forst.
Während Veronika dem elterlichen Forsthaus am Rande von Nürnberg entflieht, um in Frankfurt Karriere als PR-Managerin zu machen, fand Anna nur in der Einsamkeit des Waldes ihre innere Ruhe und ihre Sprache wieder. Dort lernte sie von der Einsiedlerin Barbara die Maxime „Wer zu lange in der Menschenwelt lebt, ist verdorben für den Wald“. Veronika will zwar das geerbte Waldgrundstück verkaufen - notfalls auch an Investoren der Papierindustrie -, bewundert andererseits heimlich die radikale Naturschützerin Rosa, die der anrückenden Polizei zuruft: „Die Befehle, die ihr befolgt, sind verbrecherisch … die nachfolgenden Generationen werden euch dafür hassen.“
Ergänzt wird das zentrale Thema „Wald“ durch eine Reihe von privaten Beziehungs-Irrungen und Wirrungen, die manchmal hart an der Grenze zum Kitsch angesiedelt sind. Klara Jahn distanziert sich zwar von der einlullenden Happy-End-Idylle der einstigen Gartenlaube-Literatur, verfällt aber mangels spürbarer literarischer Ambitionen häufig in die modernen Problem-Klischees, die man aus einschlägigen Fernseh-Serien wie „Bergdoktor“, „Lena Lorenz“ oder „Kudamm 63“ kennt.
Ein Roman, der mit einem tausendjährigen (!) „starken donnerdunklen Rauschen“ aus dem naturalistischen Gedicht „Waldesstimme“ von Peter Hille einsetzt und eine uralte deutsche Eiche ins Zentrum des Geschehens stellt, muss unter Ideologie-Verdacht gestellt werden und mit fragwürdigen Deutungen rechnen. Da täte es gut, wenigstens als dosiertes Gegengift Henry David Thoreaus „Walden“ oder Thomas Bernhards „Holzfällen“ mitzulesen.
https://www.penguinrandomhouse.de/Taschenbuch/Das-Lied-des-Waldes/Klara-Jahn/Heyne/e612022.rhd

Tonio Schachinger: Echtzeitalter ****
Rowohlt Verlag (Hamburg 2023)
ca. 360 Seiten, 24,00 Euro
Dass österreichische Schriftsteller in der Lage sind, die Leiden der jungen Schüler in eindrucksvolle Prosa zu fassen und dabei auch schmerzliche eigene Erfahrungen einzubringen, haben Robert Musil („Die Verwirrungen des Zöglings Törless“, 1906), Friedrich Torberg („Der Schüler Gerber“, 1930) und Thomas Bernhard („Die Ursache“, 1975) bewiesen. Tonio Schachinger übersetzt nun diese Tradition mit seinem Roman „Echtzeitalter“ ins 21. Jahrhundert.
Dafür platziert er sein Alter ego Till Kokorda für acht Schuljahre in das elitäre Wiener Halb-Internat Marianum (im Original heißt es Theresianum, in der Jugendsprache Marihuanum!), wo dieser kleine rothaarige Junge sich zunächst als „Naturtalent in der Kunst des Nichtauffallens“ übt, dann aber - nach dem frühen Tod seines Vaters - in der 5. Klasse (in Deutschland wäre es die 9.) schlagartig erwachsen wird und den bekannten Friktionen des Coming of Age ausgesetzt ist. Er erlebt die toxische Mischung aus Wohlstandsverwahrlosung, schulischem Druck und Eigentumsleerstand, er ist den fast sadistischen Launen seines Deutsch- und Französischlehrers Dolinar ausgesetzt, der von der Prämisse ausgeht, die Schüler seiner Klasse „seien alle zu nichts zu gebrauchen“, und er muss den harten Zwiespalt zwischen einer möglichen Karriere als Profi-Gamer („Age Of Empires 2“) und der literarischen Allgemeinbildung mit Adalbert Stifters „Brigitta“ als Schullektüre koordinieren.
Gleichzeitig ist er „auf völlig aussichtslose Weise“ in die Schulkameradinnen Fina und Feli verliebt, beides Töchter finanzstarker Eltern, die ihn auch in das Wiener Nachtleben mit Spritzer, Joints und Ecstasy einführen. Über die Gründung eines schuleigenen Literaturzentrums, über ausgiebige Gespräche im Rauchereck, über Klassenfahrten nach St. Petersburg und ins KZ Mauthausen arbeitet er sich in den Abiturjahrgang hoch. Er kann es sich sogar ehrgeizlos leisten, bei der geforderten Textanalyse zu Robert Walsers lakonischer Kurzgeschichte „Basta“ ein leeres Blatt abzugeben. Kurz nach dem Abi trifft er seinen ehemaligen Klassenkameraden Palffy, der jetzt den Militärdienst ableistet und eine verklärte Sicht auf die Schulzeit artikuliert: „Es war schon super, eigentlich“. Da muss Till widersprechen: „Es war die Hölle, du Idiot!“
Schachingers Protagonist besitzt die analytische Stärke des Autors und hält der Gesellschaft wie dem Schul-System (aber auch der eigenen Generation!) einen höchst ironischen Eulen-Spiegel vor. Der junge Österreicher, der mit seinem kundig-kritischen Blick auf die Welt des Profifußballs bei seinem Roman-Debüt „Nicht wie ihr“ 2019 in die Shortlist des Deutschen Buchpreises einzog, hat mit „Echtzeitalter“ einen grandiosen Nachfolger geschrieben. Er hätte es verdient, in den Kanon der deutschsprachigen Schul-Lektüren aufgenommen zu werden. Es wäre echt Zeit, Alter!
https://www.rowohlt.de/buch/tonio-schachinger-echtzeitalter-9783498003173

Benedict Wells: Hard Land ****
Diogenes Verlag (Zürich 2021)
ca. 345 Seiten, 24,00 Euro
Was ist das für ein (männlicher) Ich-Erzähler: am Anfang des Romans steht Sam Turner kurz vor seinem 16., am Ende kurz vor dem 17. Geburtstag. Er ist also der archetypische Coming-of-Age-Protagonist, der gleich im ersten Satz, die Brocken spoilert, die in seinem Weg liegen werden: „In diesem Sommer verliebte ich mich, und meine Mutter starb“. Doch das ist kein so dahingesagtes Intro, es ist eine Abwandlung des Romananfangs von Charles Simmons „Salzwasser“: „Im Sommer 1963 verliebte ich mich und mein Vater ertrank“. Mit seine Freundin Kirstie Andretti sammelt Sam nämlich - fast wie in einem Germanistik-Proseminar - starke Roman-Auftakte und schafft damit eine literarisch anspruchsvolle Meta-Ebene.
Bei Sam ist es jedoch der Summer of 85, der seine Gefühle in Wallung bringt, die von Kirstie wortspielerisch als Euphancholie diagnostiziert werden, eine spannungsreiche Mischung aus Glück und Schwermut. Und damit nicht genug: Sam muss in der Schule den Gedichtband eines gewissen William J. Morris („Hard Land“) analysieren, ein Zyklus von etwa 90 Gedichten über einen Jungen, „der den See überquert und als Mann wiederkehrte“. Da denkt man doch gleich an Peter Maffays Deutsch-Schnulze „Es war Sommer“: „Ich war 16 und sie einunddreißig … wir gingen beide hinunter an den Strand / und der Junge nahm schüchtern ihre Hand / doch als Mann sah ich die Sonne aufgehn“.
Bei Benedict Wells‘ Roman, der in Grady, einer fiktiven Kleinstadt im Staate Missouri spielt, bildet freilich eine ganz andere Musik den Soundtrack: „Don’t Stop Believin‘“ von Journey, „Dancing With Myself“ von Billy Idol, „The Joker“ von Steve Miller und diverse Hymnen von Bruce Springsteen, die Sams älterer Freund Hightower aus der Musikanlage seine Pick-Ups („Bruce-Mobil“) dröhnen lässt. Schließlich ragt noch ein weiteres Medium in die Handlung hinein: Sam arbeitet in den Ferien in dem kleinen Programmkino „Metropolis“, das Kirstie Vater besitzt. Dort laufen passende Kult-Filme wie Bogdanovich‘ „Last Picture Show“, „American Graffiti“ von George Lucas, „Breakfast Club“ und „Ferris Bueller‘s Day Off“ von John Hughes.
Da hat also jemand - und dieser Jemand ist natürlich Autor B. Wells - kräftig in der US-amerikanischen Jugendkultur der 80er Jahre recherchiert, um so seinem Sujet die nötige Authentizität zu geben. Die Hauptperson wird auf diese Weise kräftig aufgeblasen, verliert aber dennoch nicht ihren identitätsstiftenden Charakter. Denn Sam Turner verkörpert als ländlicher Holden Caulfield vom ersten Kuss bis zur ersten Rausch-Party, von der ritualisierten Mutprobe auf der Ladefläche bis zum Schock über den Tod der Mutter, von der Aussprache mit der älteren Schwester bis zum Scrabble-Spiel mit dem geläuterten Vater jene aussagestarken Verszeilen aus dem (erfundenen) Hard-Land-Epos: „Kind sein ist wie einen Ball hochwerfen / Erwachsenwerden ist, wenn er wieder herunterfällt“.
Der Jury des Deutschen Jugendliteraturpreises war von dem Roman angetan und kürte ihn 2022 zum Sieger in der Altersklasse ab 15.
https://www.diogenes.ch/leser/titel/benedict-wells/hard-land-9783257071481.html

Lena Gorelik: Meine weißen Nächte (Roman) ***
Schirmer Graf Verlag (München 2004)
ca. 270 Seiten, nur noch antiquarisch erhältlich
Als 23jährige schrieb Lena Gorelik 2004 diesen Debütroman, nachdem sie zwölf Jahre vorher mit ihrer russisch-jüdischen Familie als sogenannte „Kontingentflüchtlinge“ nach Deutschland gekommen war. Damit hat sie eine deutliche biografische Parallele zu der drei Jahre älteren Alina Bronsky, die etwa zur selben Zeit (1992) aus Russland in den Westen zog und dann mit ihrem Roman „Scherbenpark“ (2008) für großes Aufsehen sorgte.
Goreliks erstes größeres Schreibprojekt hat allerdings deutlich mehr autobiografische Elemente, das heißt Anja Buchmann, die Ich-Erzählerin im Roman, ist mehr oder weniger das Alter ego der Autorin. Diese Anja hat den Anspruch, auf drei verschiedenen Zeitebenen drei verschiedene Themenschwerpunkte zu setzen: zunächst die Migrationsgeschichte mit Rückblicken auf die Ausgangslage in St. Petersburg, dann die Integrationsgeschichte in Baden-Württemberg mit den ersten Erfahrungen im Asylbewerber-Wohnheim, in der Förderklasse und im alltäglichen Leben, schließlich noch eine Beziehungs-Dreiecks-Geschichte als Studentin in München mit dem deutschen Lebenspartner Jan und dem russischen Ex-Geliebten Ilja. Es vermischen sich also sehr private mit politischen, gesellschaftlichen und historischen Erfahrungen zu einer recht locker und unspektakulär erzählten Geschichte, die auch das Coming-of-age eines jungen Mädchens einbezieht. Gorelik hat sich sprachliche Magerkost verordnet (Lakonik und Ironie inbegriffen) und plaudert sich eher anekdotenhaft durch die 46 Kapitel. Allein die Wechsel der Zeitebenen verweisen ein bisschen auf Grundlagen der modernen Erzähltheorie.
Anja (wer sie mag, sagt „Anjetschka“) wächst als Zehnjährige in der krisenhaften Phase der Gorbatschow-Regierung auf, verweigert das obligatorische Pionier-Halstuch, weil sich in den gebildeten Kreisen der St. Petersburger Stadtgesellschaft die Überzeugung durchsetzt, dass im Westen alles, in Russland dagegen nichts gut ist. Im wiedervereinigten Kohl-Deutschland erlebt sie dann einen vergleichsweise gut funktionierenden Staat mit einer noch vorhandenen Willkommenskultur, mit Aufstiegschancen und hoher Lebensqualität (Wohnung mit eigenem Zimmer und eigenem Bad!). Im Gegensatz zu vielen anderen - eher kritischen - Beispielen der Migrationsliteratur schildert sie eine - trotz kleiner Mentalitäts-Unterschiede - gelingende Integration für sich und ihre Familie sowie ein Gefühl, bald mehr Deutsche als Ex-Russin zu sein.
So ist es nachvollziehbar, dass in dem Roman zum Ende hin ihr Problem zunehmend ein Beziehungsproblem ist: gehört sie eher zu dem soliden und fleißigen Jan oder doch zu dem erotisch reizvolleren Ilja? Die Zubereitung eines russischen Kartoffelsalats (mit Rezept auf Seite 273) in der heimischen Küche gibt darauf eine vorläufige Antwort.
Das "kommunikative" Problem des Buches ist zum einen die Tatsache, dass die Geschichte durch die Ereignisse seit 2014 praktisch überrollt worden ist. Wenn Lena Gorelik heute eine Lesung macht (sie hat mittlerweile sechs weiterer Romane geschrieben), wird sie zu 90 Prozent über Putins Ukraine-Krieg und über ihre Einschätzung des „russischen“ Zivilisationsbruchs befragt. Zum anderen ist der Schirmer Graf Verlag seit 2015 nicht mehr auf dem Markt, der Roman also nur noch antiquarisch erhältlich.

Juli Zeh / Simon Urban: Zwischen Welten (Roman) ****
Luchterhand (München 2023)
444 Seiten, 24,00 Euro
Das Phänomen der gespaltenen Gesellschaft geistert durch die politischen Analysen der letzten Jahrzehnte. Dabei wird oft übersehen, dass dieser Zustand für Gesellschaften mit konkurrierender Mehrheits-Demokratie zunächst etwas ganz Normales ist. Entscheidend ist allerdings die Frage, wie zivilisiert die Kommunikation im demokratischen Prozess abläuft. Genau das scheint ein Thema zu sein, das Juli Zeh auf den Nägeln brennt und das sie nun sogar in gespaltener Autorenschaft zusammen mit Simon Urban („Plan D“) zu einem neuen Roman verarbeitet hat.
Das Jahr 2022 (genauer: die Zeit vom 5. Januar bis zum 4. Oktober) bildet den zeitlichen Rahmen für einen digitalen Briefroman, bei dem sich Theresa Kallis (43) und Stefan Jordan (46) via E-Mail, WhatsApp und Telegram austauschen. Daraus entsteht ein „schonungslos ehrlicher Briefwechsel“, eine Art „schriftliche Konfrontationstherapie“ und die Erkenntnis, dass die Linie, die die beiden trennt, das ganze deutsche Land durchzieht.
Wie der Titel schon andeutet, stammen die beiden aus ziemlich verschiedenen Welten: sie ist Bio-Bäuerin in der brandenburgischen Provinz und meditiert gerne beim Melken, er ist Kulturchef einer großen Hamburger Wochenzeitung („Der Bote“) und träumt von elitärem Lighthouse-Journalismus - vor zwanzig Jahren haben sie gemeinsam in Münster Germanistik studiert und eine platonische WG-Beziehung gehabt. Ihr Hauptproblem ist die Existenzgefährdung der kleinteiligen ökologischen Landwirtschaft, seine Grübelei richtet sich auf die Krise der gedruckten Zeitungen.
Daraus entsteht ein unterhaltsamer Versuchsaufbau über die zerstörerischen Kräfte der sozialen Medien und über die (Un-)Möglichkeit einer rationalen Debatten-Kultur, die Jürgen Habermas einst im Rahmen einer herrschaftsfreien Struktur der Öffentlichkeit eingefordert und erhofft hatte. Gleichzeitig ist der Roman auch eine Dokumentation von wechselseitiger (privater) Anziehung und Abstoßung. Wer Lust auf Schlüsselroman-Spekulationen hat, könnte sogar von einem anonymisierten E-Mail-For-You-Drama zwischen Giovanni di Lorenzo und Sarah Wiener (die am Ende zur Beate Klarsfeld wird) sprechen.
Es rappelt in den neun Monaten manchmal heftig im Briefkasten, wenn die beiden über ihre persönlichen Probleme, aber auch über gesamt-gesellschaftliche Themen wie Gender-Sprache, Ukraine-Krieg, Klima-Aktivismus und Medien-Mobbing - mal im Kurznachrichten-Tempo, mal mit längeren Mails - streiten. Doch es gibt auch versöhnliche und vorbildhafte Situationen, in denen Theresa und Stefan sich loben, weil sie gelernt haben, „über empfindliche Themen zu sprechen, ohne sich digital anzuschreien“. Ein analoger Neu-Anfang ihrer Beziehung mit einer spontanen Reise an den Bodensee (Besuch bei Martin Walser, dem Idol ihres Studiums!) und einer gemeinsamen Wohnung mit Talk am Esstisch in Hamburg wird angedacht, doch dramatische Zuspitzungen im letzten von drei Roman-Teilen machen das unmöglich. Theresa fühlt sich von einem pervertierten System in den Abgrund getrieben und Stefan sieht neue Karriere-Chancen als Co-Chefredakteur der politisch korrekt umbenannten „BOT*IN“. Die Konsequenz für ihre Kommunikation lautet: mail delivery failed: returning message to sender.
Das erfolgsverwöhnte Schreib-Duo Zeh & Urban hat den Roman nicht als verteiltes Rollenspiel konzipiert, sondern als gemeinsamen Arbeitsprozess mit kooperativer Charakterisierung der Hauptpersonen gestaltet. So kann man diesen Jahresrückblick 2022, der gleichzeitig wohl den Abschluss von Juli Zehs Präpositionen-Trilogie („Unter Leuten“, „Über Menschen“, „Zwischen Welten“) markiert, als unparteiischer Beobachter mit Sympathie, Zorn oder Verwunderung begleiten - Bestseller-Garantie inbegriffen.
https://www.penguinrandomhouse.de/Zwischen-Welten-von-Juli-Zeh-und-Simon-Urban/aid92378.rhd#Das-Buch

Annie Ernaux: Der Platz ****
aus dem Französischen von Sonja Finck
Suhrkamp Verlag (Berlin 2022) / Originalausgabe: Paris 1983
ca. 95 Seiten, 11,00 Euro
Zu den unangenehmsten Phänomenen in Hotel-Wellness-Anlagen gehören das Reservieren von Ruheraum-Liegen durch Handtücher und das bescheidene Niveau der Lektüren, die in solchen Liegen konsumiert werden. Deshalb hat sich der Verfasser dieser Zeilen zu einem kleinen Experiment entschlossen: er hat einen Liegestuhl mit Annie Ernauxs kleinem Büchlein „Der Platz“ belegt und in sicherer Entfernung zwei Stunden lang auf Reaktionen gewartet. Das Ergebnis: die „Platz“-Belegung wurde kommentarlos respektiert, kein verweilender Blick richtete sich auf das Taschenbuch mit dem Aufkleber „Nobelpreis der Literatur 2022“. Was man daraus schließen kann: die Besucher von Wellness-Anlagen sind konflikt- und kommunikationsscheu, ganz auf sich und ihr Wohlbefinden konzentriert. So konnte der Reaktions-Tester den Platz wieder freigeben und sich in weiteren zwei Stunden ganz der vollständigen Lektüre dieses „Romans“ widmen.
Für ihn war es die erste Begegnung mit der französischen Nobelpreisträgerin, was man jedoch nicht als Kennzeichen literarischer Ignoranz auslegen sollte, da es schon häufiger PreisträgerInnen gegeben hat, die im deutschsprachigen Raum noch relativ unbekannt waren, bei denen die Verlage erst nach der Preis-Bekanntgabe mit dem Nach- oder Erstdruck begonnen haben.
Genauso wie Ernauxs wohl berühmtester Roman „Die Jahre“ ist „Der Platz“ autobiografisch geprägt, hat aber nicht die eigene, sondern die Person des Vaters im Blick. Man fühlt sich in vielem an Peter Handkes Rückschau auf seine Mutter („Wunschloses Unglück“) erinnert - und dennoch ist es ganz anders. Annie Ernaux scheut jedes Anzeichen von Kunstgewerbe und schreibt eher ein nüchternes Soziogramm über einen Mann, der seinen Platz knapp oberhalb der Sphäre der Armut findet, der sich in einer stets heiklen Situation zwischen kleinem Glück und Fremdbestimmung zurechtfinden muss und dies mit dem ideologischen Motto man sollte „nicht zu hoch hinauswollen“ kaschiert.
Er will nach Erfahrungen als Knecht auf einem Bauernhof kein Arbeiter sein, eher ein Schein-Selbständiger, der sich, seine Frau und seinem Kind mit einem Kramladen plus Alkoholausschank sowie zeitweisen Nebenjobs über Wasser hält. Er gönnt der Tochter, dass sie es einmal besser haben soll (Schule, Studium, Verbeamtung als Lehrerin), diese muss aber erkennen, dass sie an der Schwelle zur gebildeten, bürgerlichen Welt den Vater in einer tieferen Schicht (von Klassen wird nicht geredet) zurücklassen muss. Der Grabstein (1899 - 1967) und dieses Buch dokumentieren ein Leben mit zwei Weltkriegen und den Erfahrungen von Grenzen.
Und beim nächsten Sauna-Quickie lese ich dann Ernauxs neuestes Mini-Werk: „Der junge Mann“ mit nur 40 Seiten!
https://www.suhrkamp.de/buch/annie-ernaux-der-platz-t-9783518471081

Von Schlachtfeldern, Schlagzeilen und Schlafzimmern
Schlüsselromane über die Hintergründe des Politikbetriebs
aus 70 bundesrepublikanischen Jahren
Normalerweise wird die (Innen-)Politik auf den vorderen Seiten von Tages- und Wochenzeitungen verhandelt, doch die Abgründe und Hintergründe dieses Themas haben auch Schriftsteller in ihren Bann gezogen. Aus aktuellem Anlass und in Erinnerung an ein Jubiläum soll hier die Frage beantwortet werden: was sind die vier wichtigsten und lesenswertesten Romane über den Politikbetrieb in Deutschland seit 1949?
1. Der Träumer vom Frieden:
Vor genau 70 Jahren veröffentlichte Wolfgang Koeppen „Das Treibhaus“, einen Schlüsselroman über die Restauration und Remilitarisierung nach 1949 in der BRD - auch wenn der Autor im Vorwort behauptet, das Tagesgeschehen sei nur ein „Katalysator für die Imaginationen des Verfassers“ gewesen. Im Mittelpunkt steht der fiktive Bundestagsabgeordnete Keetenheuve (SPD), ein einsamer Kämpfer für Gewaltlosigkeit, gegen Militarismus und Nationalismus. Im Bonner Parlament steht die Debatte über die Beteiligung der BRD an einer neuen Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) an, und Keetenheuve, in dem viele Züge von Carlo Schmid zu entdecken sind, verfällt vier Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs in Resignation: Man spielte wieder das alte Spiel und „die Bundesrepublik spielte mit“. Sein Parteifreund Knurrewahn (= Kurt Schumacher?) versucht ihn umzustimmen: man könne sich doch auch eine patriotische Truppe mit sozial und demokratisch denkenden Generälen vorstellen! Mit dem Angebot eines Botschafterpostens in Guatemala versucht man ihn von seiner pazifistischen Haltung und einer Widerrede im Plenum abzuhalten. Doch Keetenheuve bleibt standhaft und tritt nach dem Bundeskanzler ans Rednerpult. Schon während seiner Ausführungen schwirren ihm Gedanken durch den Kopf: „er wollte abtreten. Es hatte keinen Sinn weiterzureden, wenn ihm niemand zuhörte; es war zwecklos“. Keetenheuves finale Konsequenz ist dramatisch: er verlässt den Bundestag und stürzt sich von einer Brücke in den Rhein; dieser Sprung „machte ihn frei“.
Angesichts der Debatten über die deutsche Haltung zu dem Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine, gewinnt Koeppens Roman neue Aktualität. Jedenfalls fand sich in der SPD-Fraktion des Jahres 2022 kein Abgeordneter, der es gewagt hätte, gegen das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr und gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine zu stimmen. Der „literarische Einsiedlerkrebs“ Wolfgang Koeppen (gestorben 1996 in München) wäre wohl auch heute ein Außenseiter, einer, der in seiner fast unpolitischen Radikalität an der Realität verzweifeln müsste.

2. Der politische Insider als literarischer Seiteneinsteiger:
Peter M. Stadler (geboren 1952) war viele Jahre im Büro eines SPD-Abgeordneten und als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fraktion tätig. Sein permanentes Nachdenken über die Prozesse im Parlament hat er 1993 in einem „Polit-Roman“ gebündelt: „Eingeschlossene Gesellschaft“ ist der vielsagende Titel. Sein literarisches Alter Ego Wolfgang Erdmann bummelt nach dem Staatsexamen (Sport, Philosophie) als Zauderer und Unentschlossener etwas ziellos durchs Leben, hat zeitweise mit einer Netzhaut-Trübung zu kämpfen und kommt dann „mit der Bonner Politik auf höchst seltsame und später folgenschwere Art in Berührung“. Der zeitliche Rahmen erstreckt sich über drei Jahre von der Wende in der DDR (1989) bis zur Protestblockade der Bundestags-Bannmeile gegen die Reform des Asylrechtsartikels 16 GG. Durch Kontakte mit Bundestagsabgeordneten erlebt Erdmann in Bonn die Bandbreite zwischen Nihilismus und Materialismus im Politikbetrieb der Kohl-Ära. Während der Ex-MdB Klaus Outland über das Phänomen des Zynismus bei Politikern reflektiert, hat sein Ex-Kommilitone Bernhard einen viel optimistischeren Ansatz: „Ich glaube, die Menschen in der politischen Arena machen ihre Sache zurzeit ganz gut“. Im Hintergrund schwelt noch eine schwierige Beziehungskiste mit der Bundestags-Bibliothekarin Ursula. Am Ende trifft Politik auf historische und private Realität: MdB Outland wird mit dem KZ Buchenwald und einer Hautkrebs-Diagnose konfrontiert.
Stadlers Roman hat zwar ein paar überflüssige inhaltliche Schlenker und einige stilistische Verstiegenheiten, dennoch liefert er eine grundsätzliche, philosophisch fundierte Auseinandersetzung mit vielen Aspekten und Krisen-Symptomen des modernen Parlamentarismus. Schade, dass das Buch derzeit nur noch antiquarisch erhältlich ist - eine Neuauflage wäre wünschenswert (allerdings wohl mit einer Revision des N-Worts auf Seite 87)!

3. Der journalistische Schnüffler:
Für die Mediendemokratie des 21. Jahrhunderts ist es bezeichnend, dass das Privatleben der Politiker zunehmend in den Fokus rückt. Der Journalist Dirk Kurbjuweit - mit leitender Funktion im Hauptstadtstudio des SPIEGEL - hat für seinen Roman „Nicht die ganze Wahrheit“ (2008) den Detektiv Arthur Koenen zur Hauptperson gemacht. Dieser soll im Auftrag von Ute Schilf („mein Mann hat ein Geheimnis“) das Berliner Liebesleben von Leonard Schilf aufdecken, pikanterweise ist jener Leo gerade Partei- und Fraktionsvorsitzender der SPD! Koenen verschafft sich Zugang zum Computer der jungen SPD-Abgeordneten Anna Tauert und stößt auf einen regen E-Mail-Verkehr unter dem Hashtag #annaliebtleo. Pech ist nur, dass die junge Rebellin Anna gar nicht den neoliberalen Politikwechsel des amtierenden Kanzlers Fred Müller (natürlich unschwer als Gerd Schröder erkennbar!) mittragen und bei einer Novelle zum Zahnersatz nicht mit ihrer Fraktion stimmen will. Leonhard Schilf hat sich aber in der „Machthaberwelt“ gut eingerichtet und möchte nach außen die Fassade einer funktionierenden Ehe erhalten - auch als Anna schwanger wird! Zusammen mit dem Basta-Kanzler bearbeitet er das naive „Mädel“; bei Wohlverhalten bekommt sie blendende Karriere-Aussichten.
Kurbjuweits Blick in die Schlaf- und Hinterzimmer der Politik beeindruckt nicht nur mit einer unterhaltsamen Story, sondern auch mit soliden Insider-Kenntnissen und einer interessanten Parallele. Der Detektiv ist nämlich auch eine Form des Schriftstellers: er komponiert (in seiner finalen Ermittlungs-Mappe) eine Wirklichkeit, die nicht unbedingt die ganze Wahrheit offenlegt. Wie sagte schon der damalige Innenminister Thomas de Maiziere 2016 über die innenpolitische Sicherheitslage: ein Teil dieser Antworten „würde die Bevölkerung verunsichern!“

4. Der Zweifler am politischen Mainstream:
Mit Christoph Peters soeben erschienenem Roman „Der Sandkasten“ schließt sich der Kreis. Der Autor bekundet gleich am Anfang die Absicht, inhaltliche und kompositorische Parallelen zu Wolfgang Koeppens Roman herstellen zu wollen. Aus dem schwülen Bonner Treibhaus von 1953 wird der Berliner Sandkasten von 2021, eine gewagte Metapher für die vermeintlich orientierungslose Politik-Spielerei während der Corona-Pandemie. Als hauptamtlicher Politik-Beobachter wird Kurt Siebenstädter vorgeführt, er ist Moderator eines Morgenmagazins bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, der zwar auf seine kritische Rolle als „Radio-Tribun“ stolz ist, aber sein alltägliches Frage- und Antwort-Spiel bald als „sinnfreies Ritual“ erkennt. Er streitet sich mit dem populären Sozialdemokraten Professor Bernburger (eine Blaupause von Karl Lauterbach) genauso wie mit dem amtierenden Gesundheitsminister Scheidtchen (aka Jens Spahn). Das Thema sex & politics entwickelt sich in den Kontakten zur attraktiven SPD-Netzwerkerin Maria Andriessen, die Siebenstädter mit gezielten Durchstechereien füttert. Gleichzeitig muss er sich mit einem unmoralischen Angebot des FDP-Chefs Martin Buchner (= Lindner) auseinandersetzen: er könnte bei dieser Partei neuer Pressesprecher werden und sich damit sein „Knallchargengerede“ vergolden lassen. Durchaus naheliegend, denn seine Position beim Sender ist wackelig, weil er zuletzt zu viele Corona-Leugner zu Wort kommen ließ. Siebenstädters resignatives Ende erinnert überdeutlich an den Abgeordneten Keetenheuve. Er erkennt die vollkommene Sinnlosigkeit dessen, was er fast zwanzig Jahre tun wollte: bloßstellen, entlarven, aufklären, durch harte (aber faire?) Kontroversen Erkenntnisse generieren. An seinem letzten Sende-Tag verlässt er abrupt das Studio, schickt eine SMS an Maria („bin schon fertig. Mit allem.“), überquert die Luisenstraße und wird vermutlich von einem LKW überrollt.
Alle vier Romane arbeiten mit einer Vermischung von fiktiven und realen Figuren und konzentrieren sich neben den jeweils aktuellen Debatten auf zentrale, zeitlose Fragestellungen: nach der Funktionsfähigkeit des Parlamentarismus, nach der Distanz zwischen Politik und Bevölkerung, nach dem Einfluss mächtiger Lobby-Gruppen, nach den Zwängen der Medien-Demokratie, nach Korruption und persönlichem Machtstreben, nach der Kompatibilität von Privatleben und politischem Amt. Auffallend ist dabei, dass die Handlung überwiegend oder gar vollständig jeweils im Umfeld der SPD angesiedelt ist. Sollte es etwa stimmen, dass diese traditionsreiche Organisation „das mit Abstand blutigste Schlachtfeld in der Parteienlandschaft“ (so lässt es Christoph Peters seine Abgeordnete Andriessen formulieren) und damit ein idealer Schauplatz für die Literarisierung der Politik ist?
· Wolfgang Koeppen: Das Treibhaus. Suhrkamp Verlag; 289 Seiten, 7,50 Euro (Tb)
· Peter M. Stadler: Eingeschlossene Gesellschaft. Ein Polit-Roman. Bouvier Verlag; 221 Seiten (nur noch antiquarisch erhältlich)
· Dirk Kurbjuweit: Nicht die ganze Wahrheit. dtv; 224 Seiten, 9,90 Euro (Tb)
· Christoph Peters: Der Sandkasten. Luchterhand Verlag; 256 Seiten, 22,00 Euro

Takis Würger: Unschuld (Roman) ***
Penguin Verlag (München 2022)
ca. 300 Seiten, 22,00 Euro
„Crime doesn’t pay“ (Verbrechen lohnt sich nicht): diese Lebensweisheit trifft zumindest auf den boomenden Markt von Regional-Krimis und True Crime Stories nicht zu. Studierte Juristen wie Bernhard Schlink, Juli Zeh und Ferdinand von Schirach haben die reflektierte Auseinandersetzung mit dem Themenfeld Schuld und Sühne zu Roman- und Theater-Bestsellern gemacht. Auf diesen Erfolgszug will wohl auch Takis Würger aufspringen, der nun mit „Unschuld“ seinen dritten Roman vorlegt.
Zunächst recherchierte der frühere SPIEGEL-Journalist zu sexuellen Abgründen bei elitären englischen Uni-Verbindungen („Der Club“), dann erörterte er die Gewissennöte der Jüdin Stella Goldschlag als Gestapo-Kollaborateurin im Berlin des Jahres 1942 („Stella“). Für seine Vermischung von historischen Fakten und erzählerischer Fiktion wurde er von einigen Rezensenten harsch getadelt.
Nun wechselt er für seinen neuen Roman an die US-Ostküste, wo zwischen New York und dem Hudson River für die Leser ein getöteter Jugendlicher, ein geständiger Mörder und mindestens drei Fragezeichen bereitstehen. War Florence Carver wirklich der Täter? Kann er von seiner Tochter Molly durch Nachforschungen vor Ort noch vor der Hinrichtung gerettet werden? Welche Rolle spielen die durch Zementfabriken schwerreichen Eltern Jonathan und Tiffany Rosendale, deren Sohn Casper (17) das Opfer war?
Mit wechselnden Erzählperspektiven und unterschiedlichen Zeitzonen entwickelt sich die Auflösung ziemlich vorhersagbar, die Charaktersierungen der Hauptpersonen sind recht plakativ und die Methode der Spannungserzeugung mit gut trainierten Cliffhangern erscheint meist formelhaft.
Erst im kurzen Nachwort bringt Takis Würger eine Unterfütterung mit Fakten und Hintergründen. Er informiert über die unheilbare Huntington-Krankheit, streift die Rolle der Waffen-Lobby und bringt statistische Angaben zum Ausmaß der Medikamentenabhängigkeit in den USA. All das - so viel sei verraten - hat etwas mit dem Ausgang der erfundenen (!) Geschichte zu tun. Vielleicht hätte er auch noch hinzufügen sollen, dass die letzte Hinrichtung in Pennsylvania 1999 stattgefunden hat und es dort seit 2015 ein regierungs-amtliches Moratorium für Exekutionen gibt.
https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Unschuld/Takis-Wuerger/Penguin/e584042.rhd

Sibylle Berg: RCE #RemoteCodeExecution (Roman) ****
Kiepenheuer & Witsch (Köln 2022)
ca. 695 Seiten, 26,00 Euro
Die Fortsetzung von GRM spielt im fortgeschrittenen Jahrtausend, der Planet ist ziemlich am Ende, aber immerhin fast voll durchdigitalisiert. Keiner glaubt mehr an irgendetwas - außer an Geld, fast jeder ahnt, „dass es nicht gut enden würde“.
Fünf Freunde (Ben, Kemal, Maggy, Pavel und Rachel) machen einen neuen Anlauf, nachdem sie schon vor fünf Jahren gegen das System gekämpft, aber aufgegeben hatten. Sie wollen - als letzter Versuch der letzten Generation? - die Welt durch einen Neustart retten, durch eine RCE, die sie in der Schweiz (das Land, in dem sich ein Drittel des Weltvermögens versammelt) zusammen mit anderen Computer-Nerds organisieren. Ihre Gegenspieler sind die Profiteure des Finanzkapitalismus, der längst die Welt beherrscht: z. B. ein Marcel, der so sein will wie Bill Gates; ein Leo, dank eines maschinell lernenden Analysesystems für Anlagen der momentan einflussreichste Mensch der Finanzwelt (verheiratet mit der Adligen Freia) und natürlich die Giganten BlackRock oder Spotify. In Nebenrollen treten noch auf: der Journalist, der Lobbyist, der Vorsitzende der EU-Kommission usw.
Überall in der westlichen Welt ist der Sozialstaat weitgehend abgeschafft, sind die Gesetzte fast komplett den Bedürfnissen der Kapitalisten angepasst. Etwa dreißig Anlegende beherrschen die Welt, aber noch ist Ruhe dank der Sattheit in Europa. Ein paar reiche Menschen („Club Of Good“) finden sich von Zeit zu Zeit, um gütig über das Schicksal der Welt zu reden
Die jungen Digital-Revolutionäre treten anders auf als früher die Linken mit ihren komplizierten Theorien: „wir suchen einen Feind, auf den sich fast alle einigen können“. Reichweitenstarke Influencer schließen dem RCE-Projekt an, z. B. der Boyband-Boy.
Die RCE-App mit dem subversiven RCE-Game wird erfolgreich programmiert und millionenfach heruntergeladen, digitale Infrastruktur wird gehackt, das Internet wird „angestochen“. Menschen erfahren, dass sie nicht in einem wunderbaren Kapitalismus leben, sondern eher in einem Neo-Feudalismus; der Boyband-Boy verkündet online: „Ihr werdet alle verarscht“ - das erzeugt Wut. Jetzt ist es Zeit für revolutionäre Parolen: Folgt den Anweisungen der RCE-App! Singt die Hymne zum Umbruch mit! Die Brigaden beginnen mit direkten Aktionen gegen die bekanntesten Kapitalisten der jeweiligen Länder; die Sagrada Familia wird gesprengt, Banken sind lahmgelegt, Menschen stürmen die letzten funktionierenden Bankautomaten, Dokumente des Eigentums werden verbrannt. Fazit: Wenn der Glaube an das Finanzsystem zerstört ist, folgt daraus die Katastrophe! Die fünf Freunde träumen: Morgen ist der erste Tag meines Lebens, alles beginnt von vorne und vielleicht wird es diesmal besser …
Das erfahren wir hoffentlich im 3. Teil („Fortsetzung folgt“ heißt es auf Seite 680)!?
Sibylle Bergs rauschhafte Wut-Prosa verfehlt auch diesmal ihre Wirkung nicht, die zweieinhalb Jahre, bzw. die 680 Seiten vergehen wie im Flug. Das gnadenlose Berg-Werk ist ein radikaler Protest, ein intelligenter Blick auf die nahe Zukunft, allerdings vorläufig mit einem Open End.
https://www.kiwi-verlag.de/buch/sibylle-berg-rce-9783462001648

Theresia Enzensberger: Auf See (Roman) ***
Hanser Verlag (München 2022)
ca. 260 Seiten, 24,00 Euro
Theresia Enzensberger, die Tochter des großen Hans hat sich in ihrem zweiten Roman Großes vorgenommen. Mit einer Mischung aus dystopischer Fiktion und historischer Recherche will sie zeigen, wie Gesellschafts- und Wirtschafts-Modelle, die in einem kleinen autarken Territorium verwirklicht werden sollen, zum Scheitern verurteilt sind, oder - um es „hart aber fair“ auszudrücken - was passiert, wenn visionäre Politik auf Realität trifft.
Als Protagonistin und Ich-Erzählerin steht die etwa 17jährige Yada im Mittelpunkt. Mit ihrem Vater Nicholas Verney lebt sie auf einer künstlichen Insel namens Seestatt in der Ostsee. Der Vater hat mit Unternehmern und Wissenschaftlern das Projekt „Vineta“ gestartet, weil nach seiner Meinung „das deutsche Festland in Chaos versunken war“. Ziel ist offenbar eine autarke, exterritoriale, nachhaltig wirtschaftende Überlebens-Gemeinschaft. Yada erkennt jedoch in dem Projekt zunehmend autoritäre Strukturen, Intransparenz und Ausbeutung von Menschen (auf dem sogernannten „Mitarbeiterschiff“), sie flieht aufs norddeutsche Festland, in dem offensichtlich noch kein Zusammenbruch zu erkennen ist.
Dort trifft sie auf ihre Mutter Helena Harold, die als Künstlerin und Influencerin mit hellseherischen Fähigkeiten eine sektenartige Anhängerschaft um sich geschart hat. Dieses „Kollektiv“ scheint sich an der Weltanschauung von Ayn Rand zu orientieren, jener Variante des Libertarismus, der die Ansicht vertritt, dass Moralität in rationalem Selbstinteresse gründe, und somit ein uneingeschränkter Kapitalismus á la Adam Smith die Lösung aller Probleme sei. Aus unklaren Gründen sammelt Helena in einer Schachtel („Archiv“) Texte über anarchistische und utopische Inselprojekte (z. B. das erfundene Königreich Poyais, Darwins tropisches Paradies auf der Insel Ascension, die Republik Nauru, das Schiff „See Org“ von Sientology-Gründer Ron L. Hubbard oder die Piratenkommune Libertatia).
Aus Angst vor einer Rückhol-Aktion des Vaters fliehen Yada und ihre Mutter in eine alternativ-kommunitaristische Zeltstadt in Berlin, wo eine gewisse Agnes die Parole ausgegeben hat: „Jeder gibt, was er kann, und nimmt, was er braucht“. Doch auch diese zukünftige Lebensform ist bedroht, denn ein Räumungsbescheid der Stadt Berlin steht unmittelbar bevor.
In einem letzten Archiv-Blatt wird das Ende von Vineta beschrieben: es sammeln sich dort zunehmend Spinner mit kruden Weltuntergangs-Fantasien, Waffenliebhaber, Steuerflüchtlinge, Reichsbürger und Prepper. Nach einem Aufstand der Mitarbeiter (allen voran Rebecca und Victor) verschwindet Vater Nicholas, die Seestatt wird aufgelöst, übrig bleiben nur noch Krebse und Algen.
Die Vermischung von privaten Familien- und Beziehungsproblemen mit der kritischen Beleuchtung von (nicht nur) neoliberalen Utopien erweist sich zunehmend als Sprengkraft für die inhaltliche Konsistenz des Romans und als Ursache mancher logischer Unschärfen. Stimmiger war da Moritz Rinkes Umgang mit dem Mythos Vineta in dem Theaterstück „Republik Vineta“ (uraufgeführt 2000 in Hamburg), wo eine Planungsgruppe von Workaholic-Männern zu einer Therapiegruppe umgedeutet und damit das Dilemma der modernen Nicht-Arbeits-Gesellschaft im Stile einer Dürrenmattschen Farce überzeichnet wurde.
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/auf-see/978-3-446-27397-9/

Takis Würger: Der Club (Roman) ****
Kein & Aber Pocket (Zürich/Berlin 2017)
ca. 240 Seiten, 12,00 Euro
Takis Würger: Stella (Roman) ****
Goldmann Verlag (München 2020)
ca. 240 Seiten, 12,00 Euro (Tb)
Takis Würger ist ein Schriftsteller mit einer guten Nase für brisante Themen; als gelernter Journalist, weiß er auch, wie man Geschichten „verkauft“, wie man Leser an der Stange hält und wie man mit gut dosierten Provokationen im Gespräch bleibt. Zwei Romane hat er bis Mitte 2022 geschrieben, beide sind keine literarischen Höhenflüge, bieten aber spannenden Stoff zum Nachdenken und sind inhaltlich voll auf der Höhe der Zeit.
In „Der Club“ erzählt er vom Coming of Age seines Protagonisten Hans, der Einblicke in das männerbündische Innere eines Studenten-Klubs in Cambridge erhält und damit zum lancierten Whistleblower über dortige MeToo-Skandale wird. Seine Freundin Charlotte hatte ihn schon frühzeitig gewarnt: „Solche Clubs sind das letzte: frauenfeindlich, elitär, dumm!“Das erinnert an die Gerüchte um den englischen Prinzen Andrew und verweist literaturhistorisch auf den deutschen „Untertan“ Diederich Heßling, dessen autoritäre Sozialisation Heinrich Mann in rechtsradikalen Studentenverbindungen der Kaiserzeit verortete.

Mit „Stella“ greift Würger ein gerade in Deutschland noch heikleres Thema auf: die Kollaboration von jüdischen Bürgern mit der Gestapo. In einer Mischung aus Fakten und Fiktion entfaltet er das Schicksal der Jüdin Stella Goldschlag, die in Berlin als „Greiferin“ für die Gestapo arbeitete und nach Kriegsende von einem sowjetischen Militärtribunal zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde.
Das gewagte literarische Konstrukt von Würger ist nun, dass er dieser historisch verbürgten Person eine fiktive Figur an die Seite stellt: den jungen Mann Friedrich (ähnelt in vielen Facetten dem Hans aus „Der Club“), der sich in sie verliebt und mit ihr zusammen das Berlin des Jahres 1942 als Ich-Erzähler erlebt. Friedrich stammt aus Genf, hat sehr wohlhabende Eltern und soll einmal an einer Kunstakademie studieren. Die Mutter ist bekennende Antisemitin, beschäftigt aber in ihrer Schweizer Villa eine jüdische Köchin.
In Monatsschritten erzählt Würger von Friedrichs Sozialisation in der Berliner Kunstszene: wie er das Aktmodell „Kristin“ kennenlernt, wie er als Nachfahre des Kästnerschen Fabians mit ihr und dem dubiosen SS-Obersturmbannführer „Baron“ Tristan von Appen das geheime Berliner Nachtleben (Babylon Berlin?) erkundet. Langsam entdeckt Friedrich, dass sich hinter Kristin die Jüdin Stella versteckt, deren Eltern von der Gestapo verhaftet worden sind. Um ihre Eltern vor dem Transport ins KZ zu retten, hat sich Stella auf einen Deal mit der Gestapo eingelassen: „wir machten uns schuldig, jeder auf seine Art“.
Die juristisch/literarische Streitfrage zu diesem Roman lautet: darf man die komplexe Lebensgeschichte einer Person (die 1994 Selbstmord beging) zu reißerischer Unterhaltung umstrukturieren? Ist der Roman gar die „Selbstentblößung eines überforderten Autors“ - so ein entrüsteter Rezensent.
Der Verfasser dieser Zeilen neigt eher zu der Verteidigung in Sascha Feucherts Nachwort: Die Mischung aus Fakten und Fiktion schafft Empathie, moralisch-ethische Ge- und Verbote nehmen der Literatur ihre Kraft. Schon bei Bernhard Schlinks „Der Vorleser“ monierten manche Leser die vermeintliche Entschuldigung einer KZ-Aufseherin. Die ambivalente Person Stella sollte von einem historisch gebildeten und rational denkenden Leser treffend eingeordnet werden können.
https://www.keinundaber.ch/de/autoren-regal/takis-wurger/der-club/984
https://www.penguinrandomhouse.de/Taschenbuch/Stella/Takis-Wuerger/Goldmann/e540451.rhd

Gustav Meyrink: Des deutschen Spießers Wunderhorn. Novellen
hrsg. v. Marco Frenschkowski
Wiesbaden 2014 (marixverlag / Verlagshaus Römerweg)
ca. 450 Seiten, 18,00 Euro
Der Band versammelt 53 frühe Texte von Gustav Meyrink (1868 - 1932), auf die der Gattungsbegriff „Novelle“ kaum zutrifft. Bei den zwischen zwei und 18 Seiten langen Texten handelt es sich eher um Satiren, kurze Erzählungen, in denen sich der Autor mit einem unverkennbaren Sarkasmus über „das Törichte“ lustig macht, gleichzeitig aber auch seine Neigung zum Okkulten, Magischen einbringt. Das Törichte findet er bei verschiedenen Gruppen der wilhelminischen Gesellschaft im Deutschen Reich bzw. der k. und k.-Gesellschaft in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Bei Offizieren, Polizisten, Richtern, Ärzten entdeckt er allerlei kleinbürgerliche Marotten, doppelte Moral, Heimatkitsch sowie esoterische Leichtgläubigkeit und Neigung zum Spiritismus.
Die Erstveröffentlichungen dieser Satiren fanden vor allem in der Zeitschrift „Simplicissimus“ in den Jahren 1900 bis 1909 statt. Die 1896 gegründete Zeitschrift benannte schon in einer der ersten Ausgaben ihre satirische Zielrichtung; unter einer Illustration von Josef Benedikt Engel wurde die Parole gedruckt: „Unseren Feinden: Dummheit, Misanthropie, Prüderie, Frömmelei“. 1913 erschien dann im Albert Langen Verlag ein Sammelband mit dem programmatischen Titel „Des deutschen Spießers Wunderhorn“. Damit wird Meyrink in eine Tradition der Kritik des Kleinbürgertums eingereiht, die mit ihm Heinrich Heine, Kurt Tucholsky, Ödön von Horváth und Bertolt Brecht betrieben haben. Die kritische Perspektive dieser Autoren auf Nationalismus, Faschismus, Klerikalismus, Kapitalismus und bürgerliche Doppelmoral wird man bei Meyrink jedoch nur in wenigen Texten finden. Interessante Beispiele in dieser Richtung könnten die Satiren „Das Automobil‘“ (S. 9 - 16), „Schöpsglobin“ (S. 140 - 149), „Dr. Lederer“ (S. 193 - 198), „Das ganze Sein ist flammend Leid“ (S. 227 - 232) und „Das verdunstete Gehirn“ (S. 260 - 268) sein. Der marixverlag hat diese Zusammenstellung 2014 neu herausgebracht und als Titelbild die Figur Diederich Heßlings (der archetypische autoritäre Charakter aus Heinrich Manns Roman „Der Untertan“) ausgewählt.
Ab 1910 wandte sich Meyrink von der Gattung der Satire ab und positionierte sich neu in dem Metier der phantastischen Literatur. Mit dem Roman „Der Golem“ (1915) landete er einen Bestseller, der seither als Klassiker dieser Gattung gilt.

Doron Rabinovic: Die Einstellung (Roman) ***
Suhrkamp Verlag (Berlin 2022)
ca. 220 Seiten, 24,00 Euro
Die Eltern des österreichischen Schriftstellers und Historikers Doron Rabinovici (geboren 1961 in Tel Aviv) redeten ungern über ihre leidvollen Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus. Aber eine Botschaft hatten sie für ihren Sohn immer parat: es kann wieder passieren! Daraus entwickelte sich für Rabinovici eine Leitlinie, die in seinem ganzen Werk sichtbar ist: gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen autoritäre Herrschaft. Im seinem aktuellen Roman „Die Einstellung“ befasst er sich mit einer fiktiven Führerfigur des neuen europäischen Rechtspopulismus.
Darin verhandelt er im Wesentlichen einen intellektuell-moralischen Zweikampf zwischen dem Parteichef Ulli Popp (mit drei P!) und dem Pressefotografen August Becker, der die rechtsradikale Fratze des Spitzenkandidaten mit seiner Kamera bloßstellen will. Keine Frage: das ist ein politisch engagierter Schlüsselroman, in dem immer wieder Charakterzüge der FPÖ-Oberen Haider, Strache oder Hickl durchschimmern, der aber mit der Figur des August Becker auch bekannte Presse-Fotografen wie Lukas Beck oder Robert Newald erkennen lässt. Die Tragik von Becker ist, dass er einerseits an die aufkärerische Macht der Qualitätsmedien glaubt („wir werden eure Lügen aufschreiben und dokumentieren … wir werden einfach sagen, was ist“), andererseits aber selbst in die finanzielle Abhängigkeit von Popps PR-Maschine gerät. Aus einem vermeintlich entlarvenden Foto von Becker, das Popp bei einem Bier-Anstich zeigt, macht der clevere Ulli ein Wahlkampf-Plakat mit dem Slogan „Schlag auf Schlag: Ulli Popp - ein Hammer für die Rechte des Volkes“. So wird der Roman auch zu einer unterhaltsamen Abhandlung über Wahrheit und Lüge in den Medien, über Korruption und Abhängigkeit. Dazu hat der schneidige Rechtsaußen eine lakonsiche Position: „Die Wahrheit ist letzlich das, was die Leute hören wollen!“
Spätestens seit 1986 gilt Rabinovici als scharfsinniger Beobachter der politischen Strukturen in der Alpenrepublik, im Jahr der Wahl Kurt Waldheims zum Bundespräsidenten war er Mitgründer des Republikanischen Clubs und bildete mit seinen Kollegen Robert Menasse und Robert Schindel eine Art Dreigestirn der Kritischen Wiener Schule. In der seit langem geführten Debatte über engagierte Literatur mit den Exponenten Sartre und Handke will er nur ganz persönlich antworten: „Ich kann nicht anders: was mir die Sprache verschlägt, muss ich zu Papier bringen!“
Dies tut er mit sprachlicher Routine und einem Hang zu feinsinniger Ironie. Seine beiden dialog-starken Protagonisten in dem Roman mit einem bewusst doppeldeutigen Titel sind keine Schwarz-Weiß-Bilder, sondern differenzierte Figuren, deren Abgründe sichtbar werden, die aber auch Ansätze für Sympathie bieten. Arthur Beckers Kindheits-Trauma - die Konfrontation mit dem Großvater - wiederholt sich, als er auf den aalglatten und medial versierten „Scheiß-Nazi“ Popp trifft. So wird „Die Einstellung“ auch zu einer nüchtern-kritischen Betrachtung der heutigen Medienwelt, gekennzeichnet durch den aufhaltsamen (?) Aufstieg der „nichtredaktionellen“ Medien“ und durch die Möglichkeit, mit Lügen die Wirklichkeit zu verändern. Ulli Popp nutzt in dem Roman seine Medien-Präsenz: „Ich komme als Aussätziger in die Arena und verlasse sie als Mitspieler“.
Der Autor Rabinovici sieht zwar, dass die Anziehungskraft der Orbans, Salvinis, Le Pens und Höckes zunimmt, klammert sich aber an den Satz von Vaclav Havel: „Hoffnung ist das Vertrauen, das Richtige zu tun!“
https://www.suhrkamp.de/buch/doron-rabinovici-die-einstellung-t-9783518430590

Sibylle Berg: GRM. Brainfuck (Roman) *****
Kiepenheur & Witsch (Köln 2020)
ca. 630 Seiten, 14,00 Euro
Bei Enid Blyton hätte der Roman vermutlich „Vier Freunde und der Traum von einer besseren Zukunft“ geheißen, bei Sibylle Berg steht die düstere Botschaft im Untertitel: irgendjemand hat der Menschheit ins Gehirn geschissen, und das ist dabei herausgekommen. Bergs Prosa-Langstrecke mit dem Kürzel „GRM“ ist eine Dystopie der nahen Gegenwart, ein Blick auf eine vermeintlich schöne neue Welt, eine schnöde (man könnte auch sagen: zynische) Abrechnung mit Hoffnungs-Trägern und Utopisten.
In dem Kaff Rochdale bei Manchester finden sich vier Jugendliche, die vom Schicksal ihrer bisherigen Sozialisation bös bestraft worden sind. Don, Karen, Hannah und Peter beschließen: „Keiner wird uns mehr verletzen … wir rächen uns an allen, die uns wehgetan haben!“ Grime (= GRM), der Punk der 2020er Jahre ist ihre Musik, der Ausdruck ihrer Wut, London ihr neues Ziel.
Weitere Personen kommen ins Spiel: Thome und sein Vater, ein führender Politiker, MI5 Piet, ein alles überwachender Geheimdienst-Mann, der Programmierer, ein Protagonist des digitalen Imperiums. Die Geschichte weitet sich zur düsteren Gesellschaftsanalyse. Wie bei George Orwells „1984“ mit Glücksspiel, werden hier die unteren Schichten mit bedingungslosem Grundeinkommen ruhig gestellt. Der Staat installiert eine lückenlose Überwachung mit implantierten Chips und Sozial-Punkte-System, Virtual-Reality-Räume ersetzen den Urlaub, Start-Up-Sklaven bevölkern die Arbeitswelt - die vier Freunde sehen sich als letzte kritische Untergrundbewegung umgeben von einer „Herde absolut dämlicher Tiere“, von einer Masse aus fleischgewordener, bedürfnisloser Zufriedenheit. Thomes Vater, das Musterexemplar des alten weißen Mannes bezeichnet die Demokratie als veraltete Technologie, als bloße „Übergangslösung zum Endziel eines technokratisch geführten Landes“. Gar nicht so zukünftig ist der Befund, dass die Welt sich erleichtert alten Diktatoren unterzuordnen scheint. Dann aber verliert der Populist Thome die Wahl gegen das perfekteste System des Populismus, gegen die Internet-Partei, die mit 80 Prozent der Wählerstimmen gewinnt und einen Avatar, einen Schauspieler (!) als Premierminister einsetzt: „die Bürger haben in der neuen, glücklich machenden, direkten Demokratie dafür gestimmt, sich komplett überwachen zu lassen“.
Und die vier Freunde erkennen neben sinnlosem Liebeskummer das Fehlschlagen ihrer revolutionär gedachten Aktion - es war nur ein weiterer Versuch, „die Welt in dieser Junge-Menschen-ändern-die-Welt-Art zu retten“. Sie werden ihren Platz in der neuen Mitte der Gesellschaft einnehmen. Die Zeitläufte gehen wunderbar und ruhig weiter als geleitete Demokratie ohne Unruhen, mit viel Kontrolle und weniger Natur. „Fast alles scheint den Menschen egal“.
Diesen deprimierenden Befund verkündet Sibylle Berg mit verbaler Härte und einer sprachlichen Radikalität, die an Brett Easton Ellis‘ „American Psycho“ oder Anthony Burgess‘ „Clockwork Orange“ erinnern. Ein deprimierender Blick auf die 2030er Jahre, ein fesselndes Stück Gegenwarts-Literatur, ein aufrüttelnder Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte!
https://www.kiwi-verlag.de/buch/sibylle-berg-grm-9783462000207

Paul McCartney: Lyrics. 1956 bis heute ****
Aus dem Englischen übersetzt von Conny Lösch
Verlag C. H. Beck (München 2021)
847 Seiten, 78,00 Euro
Zum 80. Geburtstag kann man dem lieben Paul McCartney etwas abnehmen: ca. 5 Kilogramm Songs für 78,00 Euro, was nach der deutschen Handelsverordnung einen Kilopreis von 15,60 Euro ausmacht. Dafür erhält man einen wuchtigen grünen Schuber mit zwei Bänden, in denen auf knapp 900 Seiten 154 Songs von Sir Paul versammelt sind. Sie stammen aus den Jahren 1956 - 2020, also von dem Lied, das er als Vierzehnjähriger anlässlich des Todes seiner Mutter Mary geschrieben hat („I Lost My Little Girl“) bis zu den Songs seines bislang letzten Albums „McCartney III“.
Die Werke sind alphabetisch - d. h. nicht chronologisch - geordnet, sie enthalten die üblichen Credits, dazu natürlich den Songtext, einen unterschiedlich langen Kommentar des Komponisten und eine bunte Mischung von Archivfotos. Die Kommentare entstanden in etwa 24 Gesprächsrunden („Sitzungen“) zwischen 2015 und 2020, bei denen sich der nordirische Dichter Paul Muldoon (71) mit Paul McCartney traf. Muldoons Affinität zur Rockmusik zeigt sich daran, dass er nach wie vor Gitarrist der Hobby-Rockband „Rackett“ ist und neben traditioneller Lyrik auch Songtexte für Warren Zevon geschrieben hat. In der Einleitung bezeichnet er seinen Freund PMC als bescheidene „Ikone des 20. Jahrhunderts“ und die Beatles als außergewöhnliche Band, denn bei ihnen „waren keine zwei Stücke gleich“.
Das Vorwort des Jubilars deutet darauf hin, dass er keine Biografie mehr über sich schreiben, sondern nur seine Songs sprechen lassen will. Als Einflüsse listet er natürlich seine Mutter, den Vater Jim, einen begabten Jazz-Pianisten, den Englischlehrer Alan Durband, der bei ihm die Liebe zu Nonsens- und Kinderreimen, zu Lewis Carroll und Dylan Thomas weckte, die musikalischen Vorbilder Chuck Berry und Buddy Holly sowie seine verstorbene Ehefrau Linda Eastman auf. Songschreiben bezeichnet er als Kompromiss zwischen persönlichen Interessen und den Erwartungen der Fans. In der Endphase der Beatles und mit seinen letzten Alben bewies McCartney, dass er es sich leisten kann, kreative Experimente zu wagen.
In einer weltweiten Hitliste von McCartney-Songs dürften zwei Titel an erster Stelle stehen: „Yesterday“ (1965) und „Let It Be“ (1970) - fachkundiger Widerspruch ist natürlich jederzeit möglich. Über „Let It Be“ erfährt man, dass Shakespeares Hamlet und Pauls Mutter mit dem Titel etwas zu tun haben und dass der Song als eine Art „Mini-Gebet“ in harten Zeiten verstanden werden kann. Bei „Yesterday“ entstand im Hause seiner damaligen Freundin Jane Asher zuerst die Melodie am Klavier, als Arbeitstext fungierten die Zeilen „Scrambled eggs, oh my baby how I love your legs“. Soviel Banalität wäre aber nicht angemessen werden: in der Endfassung schwingt wieder der Tod der Mutter zwischen den Zeilen und ein originelles Streicher-Arrangement schickt die Beatles ins Kunst-Gewerbe und den Song auf Platz 1 der besten Songs des 20. Jahrhundert (laut „Rolling Stone“). Das Original-Textblatt für „Yesterday“ kann übrigens im British Museum bestaunt werden.
Eine musikhistorisch interessante Frage umschifft der harmoniesüchtige Paul McCartney allerdings weitgehend. In der Beatles-Ära traten John Lennon und Paul McCartney als festes Songschreiber-Duo auf, unabhängig davon, wer nun wieviel kreative Arbeit in einen Song investiert hatte. Das führte nach 1970 zu einigen Streitereien über die tatsächliche Autorenschaft., zum Beispiel bei den Titeln „Eleanor Rigby“ und „Ticket To Ride“ - beide sind aber in McCartneys Buch präsent. Unbestrittene Alleingänge von John Lennon wie „Strawberry Field Forever“, „All You Need Is Love“ oder das Beatles-Porträt „Come Together“ wurden ausgelassen. Insgesamt bezeichnet Paul McCartney seinen langjährigen Partner als großes Vorbild, als eine Art großer Bruder, aber auch (manchmal) als „totalen Idioten“. Das immer respektvolle gemeinsame Songschreiben sieht er als „kleines Wunder“.
Es lohnt sich also, acht Regalzentimeter freizumachen und immer wieder durch diese Schatzinsel mit Songs, Bildern und Erinnerungen zu streifen; ach ja: „Die Schatzinsel“ von Robert Louis Stevenson war auch das erste Buch, in das sich Paul McCartney als kleiner Junge verliebt hatte.

Annika Büsing: Nordstadt ****
Steidl Verlag (Göttingen 2022)
125 Seiten, 20,00 Euro
Aus dem Mathematik-Unterricht kennen wir die Formel: Minus mal Minus ist Plus. Das scheint auch das Konzept des Debütromans von Annika Büsing zu sein: zwei Loser treffen aufeinander und gewinnen am Ende (vielleicht) ein zufriedenstellendes Leben.
Nene und Boris sind zwei junge Erwachsene, auf die - wie mit einem Brennglas - soziale Härten abgeladen wurden: Nenes Mutter starb an Krebs, der alleinerziehende Vater ist Alkoholiker, er schlägt immer wieder seine Tochter („als Familie waren wir aufreizend asozial und arm“); im Alter von 17 Jahren wurde Nene von einem anderen Jugendlichen vergewaltigt. Das alles hat sie hart gemacht, gleichzeitig aber auch durch Realschule und Berufsschule zum Beruf der Bademeisterin geführt. Denn das Schwimmen war schon immer ihre Leidenschaft, vielleicht auch als ein Sinnbild, wie man den Kopf über Wasser hält.
Boris erkrankte mit zwei Jahren an Kinderlähmung, weil seine Mutter ihn nicht impfen ließ, seitdem ist er gehbehindert, ein „Krüppel“ und ein Misanthrop. Zu oft hat man „Das kannst du nicht“ zu ihm gesagt, er selbst bezeichnet sich als „vom Tode markiert“, verleugnet seine Arbeitslosigkeit und verfällt immer wieder in Resignation: „Das ist alles ein großer Irrtum hier“.
Im Schwimmbad lernen sich die beiden kennen, im Kino kommt es zu ersten Annäherungen, im Bett aber auch zu er(n)sten Problemen.
Die Geschichte wird aus der Ich-Perspektive von Nene erzählt; von ihrem Deutschlehrer an der Realschule hat sie die Vorzüge der lakonischen Sprache erlernt, die aber oft in einen explizit-derb-vulgären Slang verfällt. Sie schlägt immer wieder Klischee- und Kitsch-Alarm, warnt vor der Metaphern-Keule und vor verschlissenen Bildern: da schimmert die textkritische Ausbildung der Autorin gewaltig durch!
Der Titel „Nordstadt“ verweist auf die sozialen Brennpunkte in Ruhrgebiet-Großstädten und erinnert ein bisschen an den legendären Song von Franz-Josef Degenhardt (1965): „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, / Sing nicht ihre Lieder, / Geh doch in die Oberstadt“. Insgesamt ein viel versprechendes Roman-Debüt mit einem geschärften Blick für die Becken-Randgruppen, das rückblickend die Hauptperson Nene wohl gerne schon während ihrer Realschulzeit im Deutschunterricht gelesen hätte.

Martin Beyer: Und ich war da (Roman) ***
Ullstein Verlag (Berlin 2019)
ca. 185 Seiten, 20,00 Euro
Romane über Schicksale in der NS-Zeit gibt es viele, wer da noch ein weiteres Angebot macht, muss schon ein überzeugendes Programm vorweisen. Diesen Anspruch will die Konzeption von Martin Beyers zweiten Roman (nach: „Alle Wasser laufen ins Meer“) einlösen. In drei Etappen soll gezeigt werden, wie ein Jugendlicher in der Hitlerjugend mit der NS-Ideologie (aber auch mit Gegenentwürfen) konfrontiert wird, wie er als junger Mann 1941 an der Ostfront zum Täter wird und wie er schließlich 1943 mit (prominenten) Opfern des NS-Regimes konfrontiert wird. Spiegelbildlich werden diese drei Kapitel umrahmt durch eine Szene am 23. Februar 1943, dem Tag, an dem sich der Ich-Erzähler August Unterseher erschießen will.
August wächst mit dem älteren Bruder Konrad auf einem Bauernhof südlich von München auf, die Mutter ist bei seiner Geburt gestorben, der alleinerziehende Vater Hermann Unterseher ist ein körperlich dominanter Haus-Tyrann, der ein strenges Arbeitsregiment führt und seinen 17jährigen Sohn fast zu Tode prügelt. Während Bruder Konrad Karriere bei der HJ und beim Reichsarbeitsdienst macht, lernt August den gleichaltrigen Paul Jansen kennen, ein jüdischer Junge mit einem ganz anderen Bildungshintergrund und der Organisator einer geheim bündischen Gruppe. 1938 verlässt Paul Deutschland, weil sein Vater ein Angebot als Arzt in Italien bekommt. Wenig später stößt August auf Isabella, die in einer alten Mühle ein geheimes Warenlager anlegt und deren Bruder Peter offensichtlich Kontakte zu kommunistischen Organisa tionen hat. Nach dessen Verhaftung ist auch Isabellas Leben gefährdet. Somit wird August zweimal mit Modellen des Widerstands konfrontiert - aber offensichtlich nicht infiziert.
Denn das zweite Kapitel enthält nun plötzlich und reichlich unvermittelt, drei sogenannte Klarträume von Kriegssituationen an der Ostfront 1941. Diese Methode der Vergangenheitsbewältigung hat ihm seine Tochter Anna, eine Psychologiestudentin, empfohlen: erst 1988 bringt August diese Träume mit drastischen Erlebnissen zu Papier.
Das dritte Kapitel schildert Augusts Aufenthalt im Lazarett, die Rückkehr an den väterlichen Bauernhof, den Kontakt mit drei Kriegsgefangenen als Zwangsarbeiter und schließlich seine Tätigkeit als Helfer des historisch verbürgten Scharfrichters Johannes Reichart. Am 22. Februar 1943 führt er mit diesem die Hinrichtung der Geschwister Sophie und Hans Scholl in München-Stadelheim durch, die dann bei ihm eine grundlegende Sinn- und Schuldkrise auslöst. In der Nacht zum 23. Februar entwickelt sich ein kritischer Gedanke in seinem Kopf: „Du hättest eine Flamme sein sollen … und bist nur eine Funzel geworden“.
Die Entwicklung des Ich-Erzählers lässt zwar aus heutiger Leser-Perspektive die Frage zu, wie man sich selber in vergleichbaren Umständen verhalten hätte, insgesamt aber bilden sich zu viele Leerstellen, bei denen die Motivation der Hauptperson nicht schlüssig analysiert wird. Die Vermischung von Fiktion und historischer Realität wirkt insgesamt eher störend und konstruiert. Wer den Typus des Mitläufers studieren will, ist beispielsweise mit Hans Werner Richters kleinem Roman „Die Stunde der falschen Triumphe“ besser bedient.
https://www.ullstein-buchverlage.de/nc/buch/details/und-ich-war-da-9783550200397.html

Knut Hamsun: Hunger (Roman) ****
aus dem Norwegischen von Siegfried Weibel
Ullstein Verlag (Berlin 2017)
ca. 230 Seiten, 12,00 Euro (Tb)
Eine Umfrage zu Beginn des 21. Jahrhunderts ergab, dass Carl Spitzwegs Gemälde Der arme Poet (1839) - gleich nach Leonardo da Vincis Mona Lisa - zu den beliebtesten Bildern der Deutschen zählt. Bei Knut Hamsuns Romandebüt Hunger (1890) dürfte unter der Rubrik „beliebtester Roman der Deutschen“ ein solches Ergebnis keineswegs zustande kommen. Thematisch sind sich die beiden Kunstwerke wohl sehr nahe, doch in der Herangehensweise an das Motiv zeigen sich gravierende Unterschiede. Während Spitzweg eine Boheme-Idylle zeichnete, die trotz der prekären sozialen Situation noch Romantik und Wärme ausstrahlt, verfasste Hamsun eine düstere Psycho-Studie, die von Kälte und Isolation geprägt ist, die einen Schreib-Künstler im Zustand psychosomatischer Debilität, zwischen Traum und Wahnsinn illustriert.
Der Ich-Erzähler - sein Name ist vermutlich Andreas Tangen - lebt in Kristiania (später Oslo) als meist arbeitsloser Schriftsteller in großer Armut. Er leidet Hunger, kann die Zimmermiete nicht bezahlen und besitzt eigentlich nur einen Bleistift, mit dem er vormals eine Abhandlung über philosophische Erkenntnis geschrieben hatte. Der handlungsarme Roman besteht im Wesentlichen aus Selbstbeobachtungen und Reflexionen, teilweise mit übersteigertem Wahrnehmungsvermögen, teilweise im existenziellen Dämmerzustand - meist als Gratwanderung zwischen subjektiver Wahrheit und Traum: „Mein verwirrter Zustand ging mit mir durch und gab mir die wahnsinnigsten Einflüsterungen, denen ich der Reihe nach gehorchte“ oder „Wie war es mit mir nur die ganze Zeit beständig bergab gegangen“. Kurze Erfolgserlebnisse mit erfolgreicher Abgabe von Texten bei Redakteuren wechseln mit Phasen der brotlosen Schreib-Kunst. Sozialhilfe oder Almosen lehnt er ab, eine undeutliche Liebesgeschichte führt nie zu stabilen Verhältnissen.
Hamsun spiegelt das verwirrte Bewusstsein eines Mannes, zeigt aber für seinen Anti-Helden keinerlei erklärende soziale Hintergründe, keine Anamnese der verfahrenen Situation. Somit distanziert er sich bewusst vom sozialen Drama des 19. Jahrhunderts, das in Skandinavien mit Ibsen und Strindberg eine große Tradition aufweist. Umso überraschender endet der Roman mit einer möglicherweise positiven Perspektive: Tangen heuert auf einem russischen Schiff als Matrose an, er verabschiedet sich auf unbestimmte Zeit von Kristiania, „wo in allen Häusern die Fenster so hell leuchteten“.
Der eindringliche Roman, zählt zu den bedeutendsten Werken der Moderne, er hat zahlreiche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts beeinflusst, darunter Marcel Proust und James Joyce.
https://www.ullstein-buchverlage.de/nc/buch/details/hunger-9783843707947.html

Sascha Filipenko: Die Jagd (Roman) *****
aus dem Russischen von Ruth Altenhofer
Originalausgabe „Trawlja“ (Moskau 2016)
Diogenes Verlag (Zürich 2022)
ca. 275 Seiten, 23,00 Euro
Hätte man es nicht schon längst wissen können? Das ist eine Frage, die im politischen Diskurs über Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine häufig auftaucht. Sascha Filipenkos Roman „Die Jagd“ ist schon 2016 erschienen, er beschreibt eine russische Gesellschaft, in der anstelle von demokratisch-rechtsstaatlicher Zivilisation das Gesetz des Dschungels herrscht, in der die Mentalität der russischen Inkasso-Mafia zum Leitbild geworden ist. Nun mag man einwenden, dass das Buch damals nur auf Russisch und sogar in einem Moskauer Verlag erschienen ist, ja dass es sogar noch für den russischen Booker-Preis vorgeschlagen wurde. Auf jeden Fall ist dieser Roman eine hellsichtige Satire, ein ziemlich unverschlüsselter Schlüsselroman mit hohem Erkenntniswert, der leider erst jetzt eine deutsche Übersetzung gefunden hat.
Filipenko erzählt genüsslich von der Familie des Oligarchen Wladimir Slawin (mit Frau und sechs Kindern), die ein Luxusleben in Südfrankreich führen, während der Vater im russischen Fernsehen antidemokratische Thesen vorträgt und als „Onkel Wolodja“ den Kampf gegen Oppositionelle organisiert. Dafür hat er unter anderem den Drogendealer Kalo und den korrupten Sportredakteur Lew Smyslow engagiert. Sie sollen den kritischen Schriftsteller Anton Quint, bei dem deutliche Nawalny-Parallelen sichtbar werden, im Rahmen einer Hetzjagd zur Strecke bringen. Quint, der über die Familie Slawin intensiv recherchiert hat, wird durch Fake-News im Netz verunglimpft, wird in seiner Wohnung terrorisiert und rastet am Ende in einer Verzweiflungstat aus.
Dies alles illustriert eine entsolidarisierte Gesellschaft, „ein Land, in dem die Mehrheit nur Lügen glauben will“ und in dem Patriotismus verwechselt wird mit der „Bereitschaft, auch die idiotischsten Ideen des Führers mitzutragen“. Filipenko sieht einen Antagonismus zwischen Gopniks (entwurzelten, gewaltbereiten jungen Männern) und der verbliebenen Intelligenzija, der offensichtlich zu Gunsten Ersterer auszugehen droht.
Als Aufbaustruktur des Romans hat sich der Hobby-Cellist Filipenko die Form des Sonatenhauptsatzes mit Exposition, Durchführung und Schlussteil ausgedacht, was dem gesamten Textgebilde etwas Kunstvolles hinzufügt und die polyphone Struktur mit einer multiperspektivischen Erzählhaltung unterstreicht. Der Weißrusse Filipenko lebte bis 2020 in St. Petersburg, danach zog er mit Familie nach Deutschland. Nebenbei: einen Booker Preis für Literatur gibt es in Russland nicht mehr, dafür werden die Schlächter von Butscha mit militärischen Orden geehrt.
https://www.diogenes.ch/leser/titel/sasha-filipenko/die-jagd-9783257071580.html

Nadine Schneider: Wohin ich immer gehe (Roman) ****
Jung und Jung Verlag (Salzburg / Wien 2021)
ca. 230 Seiten, 22,00 Euro
Man kann eine Fluchtgeschichte auch mehrfach erzählen; wenn man entscheidende Parameter verändert, entsteht daraus sogar eine erweiterte Perspektive. In dem hochgelobten Debütroman „Drei Kilometer“ (2019) von Nadine Schneider stand die Ich-Erzählerin Anna vor der Frage „Gehen (nach Deutschland) oder bleiben (in Rumänien)? Sie entschied sich (vorläufig?) für die familiäre Bindung und gegen das unkalkulierbare Risiko eines Neuanfangs. Ihre leicht problematische Dreierbeziehung zu Hans und Misch löste sich durch die Flucht des Letzteren.
Im Folgeroman „Wohin ich immer gehe“ ist die aus der Er-Perspektive beleuchtete Hauptperson nun männlich, heißt Johannes Seeler, und das erste Kapitel schildert seine abenteuerliche Flucht von Rumänien nach Jugoslawien als mutiger Schwimmer an einer engen Stelle der Donau. Schließlich landet er in Nürnberg und arbeitet dort als Angestellter in einem Hörgeräte-Laden. Er hat sich gegen sein Geburtsland entschieden und sucht neue Chancen im freien Westen. Als er jedoch 1993 vom Tod des Vaters erfährt, sieht er die Verpflichtung, eine Reise in die Gegend von Temeswar und damit eine Reise in die Vergangenheit anzutreten, zu der auch die homosexuelle Jugendbeziehung zu seinem Freund David gehört.
Mit sicherer Hand springt die Autorin in der Chronologie zwischen den komplizierten Familienstrukturen im Banat und der herausfordernden Neu-Integration im Frankenland. Das Begräbnis öffnet alte Wunden wie etwa den Selbstmord des jüngeren Bruders, an dem der Vater offensichtlich nicht ganz unschuldig war. Insgesamt erkennt Johannes, dass die Lüge, das Geheimnis und die Ausrede konstituierende Faktoren seiner Familie waren. In Nürnberg bietet ihm dagegen Kollegin Giulia neue Freizeit-Kontakte an und bezeichnet ihn schon als „waschechten Franken“. Er besteht die Gesellenprüfung als Hörgeräte-Akustiker, mietet sich einen eigene Wohnung und leistet sich einen Italienurlaub an der Adria.
Metaphorisch ist der ganze Roman kunstvoll mit zwei Leitmotiven durchzogen: dem Schwimmen gegen die Strömung, das natürlich auch politisch verstanden werden kann, und der Schwerhörigkeit, die auf kommunikative Störungen verweist. Nadine Schneider ist eine Meisterin des unsicheren Erzählens, lässt Leerstellen und verzichtet auf einen abgerundeten Schluss. Sie schreibt über ihre Hauptperson Johannes: „Er erzählte das alles und es war gelogen … für seine Wahrheit hatte es damals keine Worte gegeben und es gab sie auch heute nicht.“
Immerhin stellt sich am Ende heraus, dass seine Taubheit auf einem Ohr nur die Folge eines hartnäckigen Schmalzpfropfens war, manches lässt sich also lösen! Und der Titel des Romans zitiert eine Verszeile aus Franz Lehars Liebeslied „Dein ist mein ganzes Herz“, das die rumänische Großmutter gern in der Interpretation von Richard Tauber anhörte: „Wohin ich immer gehe, ich fühle deine Nähe“. Dennoch kommt Nadine Schneider nie in die Gefahr, ein operettenhaftes Land des Lächelns zu zeichnen!

Nadine Schneider: Drei Kilometer (Roman) ****
Jung und Jung Verlag (Salzburg/ Wien 2019)
ca. 150 Seiten, 20,00 Euro
Eine auf den ersten Blick unpassende Assoziation: Der Deutsch-Rock-Star Peter Maffay wanderte 1963 mit seinen Eltern aus dem rumänischen Braşov (Kronstadt) nach Bayern (Mühldorf am Inn) aus. 1976 veröffentlichte er sein damals sechstes Album mit dem Titel „Und es war Sommer“, im Titelsong heißt es: „Ich war 16 und sie 31 / Und über Liebe wusste ich nicht viel / Sie wusste alles und sie ließ mich spüren / Ich war kein Kind mehr“.
Was hat das mit Nadine Schneiders Debütroman „Drei Kilometer“ zu tun? Ihre Eltern wanderten aus dem Banat nach Deutschland aus, wo sie 1989 in Nürnberg geboren wurde. Ihr Roman „Drei Kilometer“ berichtet vor allem vom Sommer 1989 in einem Dorf nahe von Timisoara (Temeswar) und neben den zeitgeschichtlichen Begleiterscheinungen geht es auch um die nicht ganz unkomplizierte Dreierbeziehung zwischen der Ich-Erzählerin Anna und den beiden jungen Männern Hans und Misch.
Der Roman pendelt elegant zwischen Alltag und existenziellen Fragen, er blickt auf die Weitrauben- und Kukuruz-Ernte, auf einen Badetag an der Temes und auf eine Geburtstagsfeier in der Konditorei, auf einen alkoholisierten Kirchweihbesuch und auf die Pflege eines verletzten Storchenkükens. Das ist authentisch erzählte Dorf-Idylle, die aber immer wieder den wichtigen Fragen Platz machen muss.
Und da steht die Alternative „Gehen oder Bleiben?“ an erster Stelle. Gleich am Anfang setzt Hans den titelgebenden Grundton: „Es sind nur drei Kilometer … bis zur Freiheit. Warum machen wir es nicht heute Nacht?“ Anna fühlt sich aber an ihre Eltern und an ihre Heimat gebunden, sie hat „keine Ahnung von Deutschland, wo sie alle hinwollen“ und fragt sich, ob es nicht auch genug sei, hier zu sein und „an manchen Abenden eine gute Suppe“ zu essen. Der Vater bekommt für den Besuch bei einem schwerkranken Großonkel in Deutschland eine Ausreisegenehmigung, kehrt aber wieder zurück, weil er nicht gewusst habe, „was ich dort noch machen soll“.
Die andere Frage - gerade für die jungen Leute - lautet, ob man gegen die Regierung Ceauşescu demonstrieren und damit die eigene Gesundheit und die relative Freiheit riskieren soll. Hans kommt verletzt von so einem Protest zurück und sagt über Ceauşescu: „Ich bete, dass er elendig verreckt. Er und seine Frau“. Am 25. Dezember 1989 wird dann die Hinrichtung des Diktators im Fernsehen übertragen.
Nadine Schneider steht in der ehrenvollen Autorinnen-Tradition von Herta Müller und Iris Wolff, es gelingt ihr, durch eine unprätentiöse Sprache und durch präzise Beobachtungen, durch eine fein ausbalancierte Mischung aus Poesie und Lakonik die Gleichzeitigkeit von persönlichen Gefühlen und revolutionären Zeitumständen auf einer Ebene zu verhandeln. Sie will auch keine Verhaltensrezepte verordnen, sondern schildert subtil die Gewissenkonflikte ihrer Hauptpersonen. Am Ende hält Anna die Papiere für die Ausreise in Händen, obwohl sie weiß: „Heute hatte ich noch ein Heim und bald schon keines mehr“.
Für den Leser im „Zeitenwende“-Jahr 2022 bietet sich noch eine weitere Assoziation an: könnte das Schicksal des rumänischen Diktators Ceausescu eine Blaupause für die weitere Entwicklung in Russland sein?

Joachim B. Schmidt: Tell **
Diogenes Verlag (Zürich 2022)
ca. 280 Seiten, 23,00 Euro
Die schweizerische Tell-Sage, die im Zusammenhang steht mit dem Unabhängigkeitskampf gegen die Habsburger Herrschaft und dem Zusammenschluss der drei Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden (1291), hat mittlerweile drei literarische Ausformungen erlebt; das Schillersche Freiheits- und Tyrannenmord-Drama „Wilhelm Tell“ (1804), die kritisch-rationale Aufarbeitung von Max Frisch mit dem Titel „Wilhelm Tell für die Schule“ (1971) und nun ganz aktuell ein deftig erzählter Abenteuer-Roman, der als Vorlage für eine Serie im Streaming-TV dienen könnte: „Tell“ von Joachim B. Schmidt - nicht zu verwechseln mit Daniel Kehlmanns historischem Roman aus dem 30jährigen Krieg „Tyll“.
Schmidt (41) ist gebürtiger Schweizer, lebt aber seit 2007 in Island, dort hat ihn der Schriftsteller Einar Karason mit seinen Sturlungen-Romanen über den isländischen Bürgerkrieg im 13. Jahrhundert zu einer Tell-Saga inspiriert - der Apfel fällt also nicht weit vom Stamm. Bei Schmidt sind jedoch die politisch-historischen und ethischen Implikationen, die Schiller so bewegt hatten, weitgehend getilgt. Es handelt sich vor allem um einen rustikalen Alpen-Krimi über einen Berg-Querdenker in den trivialen Traditionen von Bergdoktoren und Bergrettern. Die zehn Kapitel enthalten knapp 100 „Szenen“, die jeweils aus einer bestimmten Personenperspektive geschrieben sind - insgesamt zählen wir am Ende 20 Erzähler, wobei Tell nur dreimal diese Rolle einnimmt. Aus den Seiten quillt recht viel mythisches Raunen von „Unheil“, von einer „Wunderkuh“ und schließlich vom Ende einer Hauptperson, die „in den Berg gegangen ist“ und seither über uns wacht - die Legende lebt, auch wenn die Zeit vergeht? Der Gegenspieler ist weniger der notorisch verunsicherte Landvogt Geßler - der schon bei Max Frisch als dicklicher und schwerkranker Herrschafts-Verwalter charakterisiert wurde - sondern eher der brutale Scherge Harras, der schließlich in einem finalen und blutigen Zweikampf auf Tell trifft.
Der Roman wirkt wie eine unverhohlene Anbiederung an Hollywood und ist damit bestenfalls als bildstarke Drehbuch-Vorlage zu empfehlen.
https://www.diogenes.ch/leser/titel/joachim-b-schmidt/tell-9783257072006.html

Kurt Fleisch: Aibohphobia (Roman) ****
Kremayr & Scheriau (Wien 2022)
ca. 175 Seiten, 20,00 Euro
Es ist die alte Frage, ob nicht die Verrückten die eigentlich Normalen seien und nur in einer verrückten Welt lebten, an die sie sich nicht anpassen können. Diese Gesellschafts- und Systemkritik führt fast zwangsläufig zu einer Kritik der Psychiatrie und zu dem problematischen Verhältnis zwischen Patient und behandelndem Arzt. Die Fragestellung tauchte schon bei Büchners „Woyzeck“ auf, wo der Doktor den Soldaten Woyzeck mit inhumanen Ernährungs-Versuchen traktiert. Die Romane von Robert Walser handeln von dem Verzweifeln an einer undurchschaubaren Welt, und die Kurzgeschichten von Franz Kafka zeigen das Individuum in existenziellen und scheinbar ausweglosen Bedrohungs- und Angst-Situationen.
In dieser Tradition ist der kleine, aber höchst originelle Brief-Roman des österreichischen Autors Kurt Fleisch zu sehen, der im Titel schon eine Diagnose und ein literarisches Konzept verrät: das Wort „Aibohpobia“ ist ein Palindrom, das man von vorne und hinten lesen kann und das gleichzeitig einen Angstzustand bezeichnet: die Angst davor, dass die Welt und die Zeit gleichzeitig vorwärts und rückwärts laufen.
Die Briefe stammen von dem in der Wissenschaft der Psychiatrie hoch angesehenen und Nobelpreis-verdächtigen Dr. H., sie sind gerichtet an seinen Patienten S. In den vier großen Kapiteln, die etwa einen Zeitraum von knapp zwei Jahren umfassen, wechseln aber plötzlich die Rollen, aus Dr. H. wird nach einem kurzzeitigen „Verschwinden“ der Patient S. und aus dem Herrn S. wird der Arzt Dr. H. - man könnte die Geschichte also auch in umgekehrter Reihenfolge von hinten lesen!
Im Grunde geht es bei beiden Personen um wahnhafte Zustände: Dr. H. arbeitet an einer Wahrheits-Maschine (einem Teilchenbeschleuniger) zur Entschlüsselung des Ursprungs sämtlicher Geisteskrankheiten, Patient S. baut sich einen vollisolierten Bunker, weil er nur so - und mit einer gehörigen Dosis sedativer Medikamente - ein Weiterleben für möglich hält.
Am Ende stehen nur Fragen: Wer ist wer? Was ist Ordnung, was ist Chaos? Was war der Anfang, was ist das Ende? Woher kommt vielleicht eine Erlösung? Wer ist der Retter (noch so ein Palindrom!)? Trotz punktueller Heiterkeit und tragikomischer Aspekte verlangt der Roman wegen möglicher Nebenwirkungen gute Nerven und Resilienz gegenüber fiktiven Zumutungen.
https://www.kremayr-scheriau.at/bucher-e-books/titel/aibohphobia/

Martin Suter: Einer von euch. Bastian Schweinsteiger **
Diogenes Verlag (Zürich 2022)
ca. 380 Seiten, 22,00 Euro
Zuerst die gute Nachricht: Bastian Schweinsteiger, der von sich sagt, er „lese“ lieber tausend Fußballspiele als ein Buch, hat diese Biografie nicht selber verfasst. Dann aber die schlechte Nachricht: die Tatsache, dass sich der renommierte Schriftsteller Martin Suter bereit erklärt hat, über die Person Schweinsteiger einen biografischen Roman zu schreiben, macht die Lektüre um keine Deut lohnenswerter. Dazu noch die überraschende Nachricht: „Einer von euch“ ist nun schon (seit Ende Januar 2022) drei Wochen in der SPIEGEL-Bestsellerliste, in der letzten Woche sogar auf Platz 1!
Doch der Reihe nach: Es beginnt schon mit der Frage, ob es eine Biografie des 37 Jahren alten Fußballspielers überhaupt braucht. Abgesehen von den tatsächlich großen sportlichen Erfolgen (Weltmeister 2014, mit Bayern München Champions League Gewinner 2013 und manches mehr) fehlt es ihm an kantigem Profil, an spielerischer Genialität und an persönlicher Ausstrahlung. Auch seine Auftritte als ARD-Experte nach dem Ende seiner Fußballer-Karriere verströmen eher Langeweile und erschöpften sich in altbekannten Floskeln. „Schweini“ ist also kein Querkopf wie einst Paul Breitner, kein Fußball-Genie wie Lionel Messi, keine tragische Figur wie Diego Maradona, nicht mal eine Ulknudel wie Lukas „Poldi“ Podolski. Um ihn als Stoff für eine Biografie zu positionieren, muss also schon sehr krampfhaft argumentiert werden. Schweinsteiger hat auf einer Pressekonferenz dargestellt, er wolle damit als Vorbild für junge Menschen dienen, eventuell für die alte Tellerwäscher-Geschichte, dass jeder eine Chance nach ganz oben hat. Genauso untauglich ist der ideologisch verschwurbelte Titel „Einer von euch“, der in den Kapiteln über Erste-Klasse-Transatlantikflüge, Ibiza-Luxus-Urlaube und dreitägige Hochzeit-Sause schlüssig widerlegt wird. Hier sollte man als realistische Alternative lieber Tonio Schachingers Roman über den wirklich fiktiven österreichischen Profi-Fußballer Ivo Trifunovic lesen, der die schöne Überschrift hat: „Nicht wie ihr“.
Nun kommt der bekannte Schweizer Schriftsteller Martin Suter ins Spiel. Wer auch immer die Idee hatte, ihn als benamten Ghostwriter einer Schweinsteiger-Biografie zu gewinnen (angeblich ein Freund des Fußballers), hat damit zwar einen originellen Marketing-Gag gelandet, aber auch gleichzeitig einen kapitalen literarischen Fehlschuss zu verantworten. Suters Vor-Bedingung, er wolle einen „biografischen Roman“ schreiben, also eine Kombination aus Dichtung und Wahrheit produzieren, funktioniert überhaupt nicht. Entweder will man etwas Authentisches - gerne auch Kritisches - über eine prominente Person erfahren oder man flüchtet gleich in die Fiktion. Die Mischform ist verwirrend und dient nur einer andächtigen Legendenbildung. Weiterhin schimmert ständig durch die Zeilen, dass der Autor Suter mit dem Thema Fußball so gar nichts anfangen kann und dass er auch jede sprachliche Originalität an der Garderobe abgegeben hat. Die kurzatmigen Kapitel, die jeweils mit einem erwartbaren Cliffhanger-Schlusssatz enden, hätte auch seine Sekretärin auf der Basis von Gesprächs-Aufzeichnungen verfassen können.

Und doch - oder gerade deswegen? - ist das Buch zum Bestseller geworden. Vielleicht sollte man also Martin Suter fragen, ob er nicht auch Lust hätte, im Trainingslager vor der Scheich-WM in Katar jeden Abend den DFB-Nationalspielern aus seinen besseren Romanen vorzulesen? Zum Beispiel aus:
Martin Suter: Elefant ****
Diogenes Verlag (Zürich 2017)
ca. 350 Seiten, 13,00 Euro (Tb)
https://www.diogenes.ch/leser/titel/martin-suter/einer-von-euch-9783257071689.html

Klaus Cäsar Zehrer: Das schreckliche Zebra. Fotos und ihre Geschichten ****
Diogenes Verlag (Zürich 2021)
ca. 250 Seiten, 25,00 Euro
Vor vielen, vielen Jahren trafen sich während einer Pestseuche zehn Menschen in einem Landhaus außerhalb von Florenz und erzählten sich an zehn Abenden gegenseitig Geschichten - diese 100 Novellen sollten später als „Il Decamerone“ in die Literaturgeschichte eingehen.
Im Jahre 2020, während des pandemischen Lockdowns saß der in Schwabach aufgewachsene Schriftsteller Klaus Cäsar Zehrer in seiner Berliner Dachbude und stöberte gelangweilt in einer alten Schachtel voller Fotos, die er nach Haushaltsauflösungen gesammelt hatte. Er beschloss zu jedem Foto eine Geschichte zu erzählen, obwohl er die abgebildeten Personen überhaupt nicht kannte und auf der Rückseite bestenfalls ein Stichwort („Onkel Willi, 1954“) zu finden war. Der Foto-Fundus seiner Bekannten Elinor Richter wurde ebenfalls einbezogen, und so entstanden schließlich 43 höchst unterschiedliche Texte zu 43 Fotos aus einer vergangenen Welt des frühen und mittleren 20. Jahrhunderts.
Zehrer versucht sich in Prosa, Dialog, Interview, Lyrik, Zeitungstext oder Auflistungen - immer kommt eine überraschende Erläuterung zustande. Man merkt dem Autor seine Lehrzeit als Satiriker im Gefolge der sogenannten „Neuen Frankfurter Schule“ an; über den großen Robert Gernhardt hat er 2002 sogar eine Dissertation verfasst und somit bestimmt viel in alten Ausgaben von pardon oder Titanic geblättert. Doch auch die Sketche von Loriot und die Wortspiele eines Willi Astor finden hier ihren Widerhall. In der Titelgeschichte geht es um einen Menschen mit Zebra-Verkleidung und um die Nonsens-Botschaft „Das Kamerun möglich machen!“ Haben sie’s girafft?
Zehrer ist nach seinem Bestseller „Das Genie“ ein schön sinnfreies Buch gelungen, in dem man genussvoll blättern kann, das man portionsweise anschauen und lesen kann, ideal für die letzten 15 Minuten vor dem grinsenden Einschlafen.

Am Ende gibt es sogar noch einen produktiven Arbeitsauftrag für Zuhause: zu dem Foto auf der Schlussseite (links abgebildet) darf sich jeder Leser eine eigene Geschichte ausdenken und an den Verlag schicken (Diogenes Verlag, Stichwort: Fotogeschichte, Sprecherstraße 8, CH-8032 Zürich). Preis für das kreativste Feedback: Vielleicht ein Sammelband der alten pardon-Beilage „Welt im Spiegel“? Oder ein signiertes Foto von Cäsar?
https://www.diogenes.ch/leser/titel/klaus-caesar-zehrer/das-schreckliche-zebra-9783257071641.html

Kenneth Bonert: Toronto. Was uns durch die Nacht trägt ***
aus dem Kanadischen von Stefanie Schäfer
Diogenes (Zürich 2021)
ca. 250 Seiten, 22,00 Euro (Hardcover)
Kenneth Bonert, der mit seinem Debütoman „Der Löwensucher“ einiges Aufsehen erregte, hat in dem neuen Buch vier Novellen zusammengestellt, die alle zwei Gemeinsamkeiten aufweisen: zum einen geht es um problematische Zweier-Beziehungen, zum anderen dient in allen Geschichten die kanadische Metropole Toronto als Hintergrund-Kulisse - mehr als das: als ambivalentes Modell einer gesellschaftlichen Struktur. Denn für Bonert, der mit seinen Eltern 1989 nach Kanada gezogen ist, erscheint Toronto als multi-ethnisches Einwanderungslabor, das er einerseits positiv als sein Zuhause erlebt: „alle kommen von woanders her … aber trotzdem gehen sie hier anständig miteinander um“, das er aber auch andererseits mit kritischen Bemerkungen versieht: „von Fremden bevölkert, Schattenmenschen, aus allen Teilen der Erde zusammengewürfelt“. Wenig erhellend ist da das Fazit, mit dem er seine dritte Geschichte („Das Paradies“) beschließt: „es gibt böse Menschen überall“.
Bonerts prekäre Beziehungs-Kisten haben mindestens zweimal etwas mit dem auch aus Porno-Videos bekannten Cougar-Motiv zu tun: ältere Frau lässt sich mit jüngerem Mann ein. Das ist in „Familienangelegenheiten“ eine 48jährige Mode-Einkäuferin, die einen 25jährigen Künstler als Untermieter ins Haus lässt. In „Willkommen im Eishotel“ ist es der jüngere Blake Morrow, der in einer Bar eine etwas ältere Frau kennenlernt, sie als Messie und definitiv unattraktiv erlebt und dennoch von ihr, die er liebevoll „Dirty Cougar“ nennt, nicht loskommt. Überlagert werden beide Geschichten durch schicksalshafte Krankheiten anderer Personen und durch das Erkennen des eigenen Versagens.
Aber auch ethnische Zugehörigkeiten spiegeln sich in den Zweier-Tragödien: Der lange verheiratete Trevor Welber (nur manchmal vergibt Kenneth Bonert richtige Namen; ansonsten bleibt es bei „sie und „er“) verguckt sich plötzlich in seine jüngere Arbeitskollegin Ping und entwickelt daraus ein Verlangen nach asiatischen Frauen, das er in schäbigen Massagesalon befriedigen will („Berührung“). In einem zwischengeschalteten inneren Monolog enthüllt er seiner Frau Trudy dieses schmutzige Geheimnis - mit offenem Ausgang. Der männliche Protagonist in „Das Paradies“ hat promoviert, findet aber - vielleicht wegen seiner asiatischen Herkunft - keinen Job und sucht mit seiner (waschecht kanadischen) Frau in einem Hauskauf nach einer Rückzugsmöglichkeit. Der Straßenlärm und die unsolidarischen Nachbarn vereiteln aber diese Idylle.
Bonert hat - in langer anglo-amerikanischer Tradition - zweifellos ein Händchen für die Entwicklung von Geschichten und Figuren, versteigt sich aber manchmal in gewollte Metaphern und reißt damit die Stories aus ihrem realistischen Netzwerk. Dennoch werden wichtige Motive wie Zuhause, Familie, Liebe und Lebensqualität kunstvoll debattiert, sie laden den Leser wegen der offenen Schlüsse zu einer Reflexion über Multikulturalismus ein.
https://www.diogenes.ch/leser/titel/kenneth-bonert/toronto-9783257071511.html

Anne Weber: Annette, ein Heldinnenepos ****
Matthes & Seitz (Berlin 2020)
ca. 200 Seiten, 22,00 Euro
Erzähle mir, o Muse, von einer sprachgewandten Frau
mit dem alltäglichen Nachnamen Weber,
die bei einer Podiumsdiskussion in der kleinen französischen Gemeinde Dieulefit
eine andere - freilich über vierzig Jahre ältere - Frau
mit fast gleichem Vornamen kennenlernte und beim anschließenden
Abendessen (man speiste Entenbrust bzw. Tintenfisch)
mehr von deren Leben erfuhr. Dieses Leben
beeindruckte sie dermaßen, dass sie immer wieder
Gespräche mit jener Anne - oder Annette - Beaumanoir führte
und schließlich beschloss, über dieses Leben ein Buch zu schreiben.
Denn Annette war für sie eine linke Leitfigur, eine moderne Heldin,
obwohl es doch in der Literatur seit dem 19. Jahrhundert
fast nur noch (männliche) Antihelden gibt.
Annette war für sie eine Pazifistin, Revolutionärin, Kommunistin, Trotzkistin,
die im Kampf gegen den Nationalsozialismus, also in der Resistance,
und im Kampf für ein freies, sozialistisches Algerien,
also an der Seite der Front de Liberation Nationale (FLN),
ihre Lebensaufgabe fand.
Die sprachgewandte Deutsche - wohnhaft in Paris,
als Schriftstellerin und Übersetzerin tätig - fand für diesen Kampf
ein eindrucksvolles Schlusswort, das sie dem Nobelpreisträger Albert Camus
abgelauscht hat: „Der Kampf, das andauernde Plagen und Bemühen
hin zu großen Höhen, reicht aus, ein Menschenherz zu füllen“.
Und wie Sisyphos darf man sich auch Annette
trotz zahlreicher Schicksalsschläge und Enttäuschungen
als glücklichen Menschen vorstellen.
Jene Frau Weber kam nun beim Schreiben auf die
Idee, dass vor Zeiten heldenhafte Menschen (meistens Männer)
dem zuhörenden Publikum in der Form des Epos vorgestellt wurden;
also in gebundener Verssprache,
oftmals in strengen metrischen Formen und mit Reimen.
Sie erinnerte sich an Homers Ilias, an das Nibelungenlied
und gar an Goethes „Hermann und Dorothea“;
sie wusste aber auch, dass praktisch ab dem 20. Jahrhundert
das Versepos ausgestorben war und dem modernen Roman Platz machen musste.
Trotzig blieb sie jedoch bei ihrem Plan - und wurde dafür belohnt:
die Jury des Deutschen Buchpreises war nicht nur von der
Lebensgeschichte einer starken Frau, sondern auch von der
stilistischen Umsetzung - man redet von souveräner Dezenz
und feiner Ironie - durch eine sprachmächtige Frau
beeindruckt und vergab dafür den Deutschen Buchpreis 2020.
Das muss ein bisschen überraschen, da zur gleichen Zeit
die feurige Autobiografie von Anne Beaumanoir
- von einem gewissen Gerd Stange - ins Deutsche übersetzt
und im engagierten Kleinverlag Contra Bass zweibändig
mit dem Titel „Wir wollten das Leben ändern“ veröffentlicht wurde.
Der Rezensent, den Altmeister Goethe fast schon einmal gern
totgeschlagen hätte, fragt sich abschließend, ob
ohne die stilistische Attitüde, das Urteil der Preisverleiher
genauso ausgefallen wäre, und er erlaubt sich den ketzerischen Zusatz,
dass man beim Lesen die Verszeilen eigentlich gar nicht mehr bemerkt -
ebenso wie hier bei dieser Rezension?!
https://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/annette-ein-heldinnenepos.html?lid=3

Dirk Bernemann: Schützenfest (Roman) ***
Heyne Hardcore (München 2021)
ca. 220 Seiten, 18,00 Euro
Man könnte die Lektüre auch mit dem Schlusskapitel auf Seite 222 beginnen. Da hat der Enddreißiger Gunnar Bäumer (gleichzeitig auch der Ich-Erzähler) einen Termin beim Psychotherapeuten in Berlin-Neukölln. Grund: „Es hat sich eine Menge angesammelt, ungute Beziehungen, Dinge und Menschen, die an mir zerren. Ich finde keine Ruhe mehr, fühle mich unfähig, den normalen Verpflichtungen eines sozial stabilen Menschen nachzukommen“. Der Therapeut erkennt eine ganze „Problemkiste“ und empfiehlt kleinschrittig vorzugehen: „Beginnen wir mit ihrer Kindheit“.
Oder beginnen wir jetzt mit Seite 5, mit einem Donnerstag, an dem Gunnar seinen Eltern mitteilt, dass er am Samstag von Berlin nach Dörrfeld in der westfälischen Provinz kommen werde, um deren Haus während ihres Urlaubs an der Nordsee für eine Woche zu hüten. Kurz zuvor hatte sich seine Freundin Anne von ihm getrennt; mit den Worten „wenn du so bleibst, wie du bist, wirst du für immer allein sein!“
Somit wäre diese Woche vielleicht eine Chance für Selbstreflexionen und für ein Fazit des bisherigen Lebens. Warum hat er es nicht zu einer festen Beziehung, zu einer Familie gebracht? Warum kann er nicht definieren, was für ihn Heimat ist? Warum ist er hin- und hergerissen zwischen seiner Berliner „Medienexistenz“ und den ambivalenten Erinnerungen an seine Jahre in der Provinz? „Ich kenne nichts, was ich mein Zuhause nennen würde“. Eine nüchterne Analyse wird allerdings dadurch verhindert, dass in Dörrfeld gerade Schützenfest ist und er in diese trunkene Stimmung hineingezogen wird, in der er vor 35 Jahren schon einmal seinen schwankenden Vater erlebt hat.
Er trifft auf alte Bekannte, Nachbarn und Jugendfreunde, besucht das Grab seiner früheren Sportlehrerin und beteiligt sich vor dem Festzelt an ausgedehnten Bier & Kümmerling-Runden - oder mit den Worten des Verfassers: „unaushaltbarer Stumpfsinn … wie Ferien auf der Schweinefarm“. Er erlebt aber auch Menschen, die in jener provinziellen Normalität Harmonie und Frieden finden - wie etwa seine frühere Freundin Franziska - und das Stadt-Land-Dilemma nimmt seinen Lauf. Gegen Ende lernt man, dass vielleicht ein Jugend-Trauma schuld an der Midlife-Crisis ist. Er war nämlich Beobachter eines Unfalls, bei dem eine Tochter (Wiebke) der Familie Siechmann gestorben ist, und den die andere Tochter (Wanda) nur mit einer schweren Behinderung überlebt hat. „Wenn man lernt, über die schlimmen Dinge hinwegzusehen, die hinter einem liegen, kann man eigentlich ein ganz okayes Leben führen. Denkt man zumindest, aber das stimmt nicht“. Und so löst natürlich auch das kleine sexuelle Abenteuer mit der 18jährigen Coco, die von der Großstadt Berlin träumt, sein Problem nicht.
Die nüchterne Umgangssprache des Romans rutscht manchmal in gefährlich konstruierte Untiefen von Bildlichkeit - etwa, wenn es heißt „wir küssten uns wie hungrige Schweine, in deren Trog unlängst zwei Eimer Kartoffelschalen geleert wurden“. Dennoch entwickelt Dirk Bernemann ein authentisches Panorama einer männlichen Sinnkrise als moderne Tragödie der Heimatlosigkeit.
https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Schuetzenfest/Dirk-Bernemann/Heyne-Hardcore/e584280.rhd

Marc-Uwe Kling: QualityLand (Roman) **
Ullstein Verlag (Berlin 2017)
ca. 380 Seiten, 11,00 Euro (Tb)
Es war einmal ein Land das Deutschland hieß, dann aber aus Marketinggründen von der staatlichen Agentur WeltWeiteWerbung in QualityLand umbenannt wurde, weil man ein Land der Superlative sein wollte. So hat Bestseller-Autor Marc-Uwe Kling („Känguru-Chroniken“) -oder auch seine in die Handlung integrierte Text-Roboterin Kaliope 7.3 - diese Geschichte konzipiert.
Das Ergebnis ist eine Rundreise durch die Systemtheorie der Zukunft (Gesellschaft, Staat, Wirtschaft, Gesundheit, Ernährung, Medien, Technologie), basierend auf einer Mischung aus Möchtegern-Satire, Dystopie, banaler Soap-Handlung mit gestanzten Dialogen, Cliffhangern aus dem VHS-Kurs „Selber schreiben“ und zahlreichen - vermeintlich auflockernden - Textbausteinen.
Kling präsentiert eine komplett dur5chdigitalisierte Welt mit einer Formaldemokratie, in der gerade der Androide John of Us zum Präsidentschafts-Wahlkampf antritt. Die eigentliche Hauptperson ist aber der Schrottpressen-Kleinunternehmer Peter Arbeitsloser (neuerdings muss man den Beruf seines Vaters bei der Zeugung als Nachnamen tragen), der sich im Laufe des Romans zu einem Michael Kohlhaas 2.0 gegen das alles beherrschende Versand-Imperium TheShop entwickelt. Er hat nämlich erkannt, dass die Menschen durch Algorithmen gesteuert werden: „sie nehmen mir die Möglichkeit, mich zu verändern, weil meine Vergangenheit festschreibt, was mir in Zukunft zur Verfügung steht“. Dingsymbol für diesen Befund ist ein Delfinvibrator, ein Sex-Spielzeug, das im von TheShop - ohne Rückgaberecht - geliefert wurde. Er kämpft sich bis zum allmächtigen Firmenchef Henryk Ingenieur durch, der auf der These besteht, das System mache keine Fehler und Peter sei ein asozialer Trieb, den man abhacken müsse.
Es folgt noch ein Finale mit James-Bond-Spannungsmuster, bei dem der gewählte Roboter-Präsident von einem „Maschinenstürmer“ in die Luft gejagt wird. Der Epilog deutet dieses Ereignis quasireligiös: John of Us habe die Schuld der Menschen auf sich genommen und sich geopfert. Viel nüchterner ist die juristische Würdigung des Vorfalls: John war kein Mensch, also handelt es sich nur um Sachbeschädigung.
Fazit: nette Details, aber literarisch äußerst dürftig - da könnte ein Delfinvibrator vielleicht mehr Spaß machen!
PS: für Mai 2022 kündigt der Verlag eine Fortsetzung an, bei der auch die Klimakatastrophe und ein Dritte Weltkrieg eine Rolle spielen soll.
https://www.ullstein-buchverlage.de/nc/buch/details/qualityland-dunkle-edition-9783548291871.html

Eugen Ruge: Follower (Roman) ****
Rowohlt Verlag (Reinbek bei Hamburg, 2016)
ca. 320 Seiten, 10,00 Euro (Tb)
Eugen Ruge ist hauptsächlich bekannt für historische Familienromane im Umfeld der Familie Umnitzer. Sei preisgekröntes Debüt „In Zeiten des abnehmenden Lichtes“ führte in die ehemalige DDR, der Roman „Metropol“ (2019) in die stalinistische Sowjetunion der 1930er Jahre - stets aus der Perspektive seines Alter Ego Alexander Umnitzer. „Follower“ schaut dagegen in die Zukunft, genauer gesagt in das Jahr 2055, wo Nio Schulz, ein Enkel von Alexander U., sich gerade auf einer Geschäftsreise in China befindet. Er soll dort eine neue Produktidee der Firma CETECH, die True-Barefoot-Running-Fußbänder, vermarkten.
Ein Tag in Wu Cheng genügt, um eine schöne neue Welt vorzustellen, in der künstliche Intelligenz den Menschen steuert, in der implantierte Chips den aktuellen Gesundheitsstatus melden, in der eine multimediale Gesichtsmaske („Glass“) für pausenlose Rundum-Informationen sorgt und in der eine Sprachautomatisierung für political correctness („pisi“) sorgt. Das Schlafzimmer im Hotel, das Frühstücksbuffet im Hotel, ein Restaurant in der Fußgängerzone und die Shopping-Mall „Alles und Jedes“ genügen mal Schauplätze, der Rest wird über die Glass eingespielt.
Ruge zeichnet mit feiner Ironie - manchmal auch mit herber Groteske - eine staatliche Gesundheitssteuerung, die an Juli Zehs „Corpus Delicti“ erinnert, und eine mediale Beherrschung des Individuums durch simulierte Realitäten, wie sie schon in dem Filmen „Die Truman Show“ oder „Lost in Translation“ vorgeführt wurde. In diesen Zeiten der abnehmenden Selbstbestimmung, wo man sich als Follower an Internet-Botschaften koppelt, sucht auch Protagonist Nio Schulz (39) nach einer Escape-Taste und findet sie tatsächlich im 7. Untergeschoß des Kaufhauses als Licht am Ende des Tunnels. Plötzlich ist er unvernetzt in einem chinesischen Dorf, kann wieder normale Geräusche der Welt hören, kann Goj-Beeren von einer Hecke pflücken, Wasser aus einem Bach trinken und normale Luft atmen. Barfuß läuft er eine Straße entlang: „er kann so ewig weitergehen“. Wirklich? Oder doch nur eine nostalgische Ruge-Idylle?
Der Untertitel kündigt 14 Sätze über einen fiktiven Enkel an. Diese erweisen sich als 14 Kapitel, die aus jeweils einem (!) atemlosen Satz bestehen - sozusagen ein postmoderner stream of consciousness, der den stream of brain control illustriert. Kurz vor dem Ende leistet sich Ruge noch einen historischen Exkurs, eine 14 Milliarden Jahre lange Geschichte vom Urknall bis zur Zeugung von Nio Schulz, „dessen Schicksal wir gerade verhandeln“. Und dieses Schicksal ist ohne Zweifel eine stimmige Projektion von einem gewissen Winston Smith in das 21. Jahrhundert.
https://www.rowohlt.de/buch/eugen-ruge-follower-9783499271717

Clemens J. Setz: Der Trost runder Dinge ****
Suhrkamp (Berlin 2019)
ca. 315 Seiten, 12,00 Euro (Tb)
Wer sich dem „literarischen Metaversum“ (so Ijoma Mangold in seiner Büchnerpreis-Laudatio) des Clemens J. Setz nähern will, fängt am besten mit der Sammlung von 20 Erzählungen an, die bei Suhrkamp 2019 unter dem Titel „Der Trost runder Dinge“ erschienen sind. Dieses Buch mischt aphoristische Kürzestgeschichten und längere Erzählungen (maximal 33 Seiten) von einem der „kreativsten, einfallsreichsten jüngeren Autoren deutscher Sprache“ (so die Jury-Begründung für die Verleihung des Jakob-Wassermann-Literaturpreises der Stadt Fürth im Jahre 2020).
Es wird - das muss man vorausschicken - keine unterhaltsame Lektüre werden, eher eine geistige Anstrengung, eine Auseinandersetzung mit verrätselten Assoziationen, Intertextualität und krassen Situation, eher ein Ausflug in die Welt von Franz Kafka oder Arno Schmidt als eine politisch korrekte Besichtigung des Realen, wie es in der jüngeren Gegenwartsliteratur häufig vorzufinden ist. Der mittlerweile 39jährige gebürtige Grazer wirkt eher wie von einer wissensgetränkten Fabulierlust, nicht von einem moralischen oder gesellschaftspolitischen Impetus getrieben, er hebt - wenn überhaupt - nur sehr dezent den moralisch-pädagogischen Zeigefinger und überlässt es dem Leser, aus den manchmal absurden, manchmal grotesken Gemengelagen seiner Figuren Erkenntnisse zu ziehen.
Es sind aber eindeutig drei Themen, die in den Erzählungen immer wieder aufgerufen werden: Krankheit, Isolation und Suche nach Wahrheit. Exemplarisch für den Kosmos der Krankheiten steht die Erzählung „Das Schulfoto“, wo die Eltern Preissner sich weigern, ein Foto der Inklusions-Klasse, in der auch ihr Sohn unterrichtet wird, zu kaufen, weil auf dem Bild ein schwerstbehinderter Junge zu sehen ist. Vater Preissner zweifelt: „Ist das überhaupt noch ein Mensch?“ Und die Mutter Annamaria engagiert in der Erzählung „Zauberer“ Callboys, um mit ihnen Sex vor dem Bett ihres Kindes, das zu Hause im Koma liegt, zu machen. Ihr Plan läuft nur darauf hinaus, dass die bezahlten Lover sich weigern - mit der Begründung, dass das Kind ja noch was mitkriegen könnte.
Das Thema Isolation führt uns zu der Schulkrankenschwester Evelyn Triegler, die ihren Job verliert und in einem letzten Kraftakt einen Schüler zu sich nach Hause entführt, oder zu dem 16jährigen Marcel, der sich in ein Erotik-Lokal einschleicht, dort an der Toilettentür seine Handynummer unter dem Namen Suzy notiert und dann den Anrufern erklärt, das sei seine Mutter, die aber gerade nicht anwesend ist.
Die Welt zwischen Wahrheit und Fake spiegelt sich in der Erzählung „Ein See weiß mehr von der Erdkrümmung als wir“. Bei einem Junggesellenabschied in Bari kommt es zu handgreiflicher Gewalt gegen einen „Albaner“, die aber die drei jungen Männer aus Österreich im Nachhinein umdeuten. Und mit „Spam“ karikiert Setz einen jener Fake-Bettelbriefe, die im Internet zuhauf kursieren.
Schließlich darf man auch noch verraten, was es mit dem rätselhaften Buchtitel auf sich hat: Setz bezieht sich auf das Bild einer verschneiten Winterlandschaft, in der es keine Ecken und Kanten mehr gibt, in der alles tröstlich von weißen Kristallen überdeckt ist: „Es ist nicht leicht zu sich selbst streng zu sein, während draußen alles im tiefsten Winter versunken ist“. Diese Metapher bleibt aber eine Einzelerscheinung im verstörenden und gar nicht erbauenden Erzählspektrum des Clemens J. Setz.
https://www.suhrkamp.de/buch/clemens-j-setz-der-trost-runder-dinge-t-9783518470961

Thomas Mulitzer: Pop ist tot (Roman) ***
Kremayr & Scheriau (Wien 2021)
ca. 190 Seiten, 20,00 Euro
Andreas Frege hat einen Bestseller geschrieben. Das verdankt er vor allem seinem Künstlernamen Campino und seiner Beschäftigung als Frontmann der Punk-Band „Die Toten Hosen“. Allerdings beschäftigt er sich in dem Roman „Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde“ weniger mit der Musik, sondern mehr mit dem englischen Fußball, insbesondere mit dem FC Liverpool. Thomas Mulitzer ist Thomas Mulitzer, macht Musik mit der etwas weniger bekannten österreichischen Mundart-Punkband Glue Crew und hat nun in seinem zweiten Roman die Geschichte des Punk-Rocks in seiner Heimat beleuchtet.
Er erzählt von den „Dead Kreiskys“, die vordem als Helden, Ruhestörer, Krawallmacher, Schreihälse, lärmende Heiden und Nomaden mit gewissem Erfolg durch Österreich getourt waren. Mit dem deutschsprachigen Song „Pop ist tot“ hatten sie sogar einen Hit. Mittlerweile sind die vier Musiker in halbwegs bürgerlichen Berufen tätig, doch Günther, der Schlagzeuger, gibt plötzlich die Parole aus: „Wir müssen zurück ins Paradies“. Er könne eine Tour als Opener für die Hütten-Gaudi-Band Superschnaps mit ihrem Bandleader Johnny Obstler organisieren. Tatsächlich machen alle mit: FX, der Sänger (und Ich-Erzähler), Branko, der Bassist (und Schlagerproduzent) und Gitarrist Hansi (früher „Hänsi“).
Doch die einstigen Ideale (wir waren eine „Schicksalsgemeinschaft“) sind zerschlissen, und aus der alten Parole „Anarchy in the UK“ wird eher eine laue Nostalgie im Ösiland. Naturnahes Vagabundenleben, Kellerkonzerte vor ein paar Junkies, Lärmorgien auf dem Feuerwehrfest in Prembergkirchen - sind das noch glorreiche Zeiten oder eher Abgesänge? So mündet der Roman folgerichtig mehr in Richtung einer Pathologie: Heiserkeit und Tinnitus, gefährliche Tabletten, der Bandbus geht in Flammen auf und Sänger FX kollabiert auf der Bühne.
Das wars? Nicht ganz: am Ende erfahren wir, dass FX als Chauffeur der Frauenband Hystera wieder on the road ist: „das Träumen hört nie auf“. Oder wie sangen die wiederbelebten ABBA: „I Have A Dream“.
Mulitzers Blick auf das Innenleben der Punk-Musik und auf die Veränderungen im Musik-Business hat den Charme der Ironie und gleichzeitig die Qualität der Authentizität. Den großen Erfolg seines deutsch-englischen Kollegen Campino wird er freilich als Nischen-Produzent nicht erreichen.
https://www.kremayr-scheriau.at/bucher-e-books/titel/pop-ist-tot/

Maxim Biller: Der falsche Gruß (Roman) ****
Kiepennheuer & Witsch (Köln 2021)
ca. 120 Seiten, 20,00 Euro
Der erste Blick auf den Umschlag erfordert schon zwei Korrekturen: es handelt sich nicht um eine kritisch-jüdische Auseinandersetzung mit Dürers „Betenden Händen“ und eigentlich auch nicht um einen „Roman“, sondern eher um eine Novelle.
Also eine kleine Erzählung über die meist hysterische Berliner Kulturszene, vielleicht sogar ein Schlüsselroman über die Fragwürdigkeit einiger schillernder Figuren im Literaturbetrieb (zu denen Autor Maxim Biller selbstverständlich auch gehört!) und eine höchst aktuelle Gratwanderung zwischen Fake und Seriosität, zwischen realen und erdachten Biografien.
Das besondere Ereignis dieser Novelle ist strafbar: denn nach § 86a StGB ist die Verwendung von NS-Kennzeichen (darunter auch des Hitlergrußes) verboten und kann mit Geld- oder Haftstrafen belegt werden. Der ambitionierte Schriftsteller Erck Dessauer wollte mit dieser „absurden Nazi-Gymnastik“ den Feuilleton-Papst Hans Ulrich Barsilay im Restaurant Trois minutes sur mer provozieren. Allerdings bleibt offen, ob er diese Geste wirklich vollständig ausgeführt hat und was die tieferen Gründe seines Handelns waren.
Jedenfalls sind damit die Hauptpersonen und die Kontrahenten angesprochen, beide ziemlich unsympathisch: der eine (Dessauer) ein „kleiner roter Nazi“, ein „verrückter, verlogener Mann“, ein neurotischer Zitterer voller Selbstzweifel, gleichzeitig ein altkluger, belesener und weltfremder Bewohner des Elfenbeinturmes; der andere (Barsilay) ein hühnchenhafter, arroganter, testosteron-gesteuerter Schönling, ein selbsternannter Kavallerist der Aufklärung, ein notorischer Besserwisser und Krawallmacher. Ständig fühlt man sich zu Spekulationen (und sogar anagrammatischen Umstellungen) veranlasst, wer wohl alles hinter diesen beiden Figuren versteckt wurde: Marcel Reich-Ranicki, Rainald Goetz, Frank Schirrmacher, Christian Kracht, der Autor selbst?
Dazu feiert die Methode der (fiktiven) Intertextualität fröhliche Urstände: Dessauer arbeitet an einer Magisterarbeit über „Spätbolschewismus als Identität und Nachteil“, später an einer Biografie über den stalinistischen Gulag-Manager Naftali Frankel, war beeindruckt von Edward Saids Sachbuch „Orientalismus“, schreibt eine Rezension über Grass‘ Biografie „Beim Häuten der Zwiebel“ und zitiert als angebliche Weltkriegs-Erinnerung seines Großvaters aus Hermann Lenz‘ Roman „Neue Zeit“. Von Barsilay wird ein fragwürdiges FAZ-Essay über die ausländerfeindlichen Unruhen in Rostock-Lichtenhagen erwähnt, sein Roman „Lustlos“ wird von einer Frau gerichtlich verboten (ähnlich ging es Biller mit „Esra“) und in seiner eigenen Biografie „Meine Leute“ hat er einen Auschwitz-Besuch hochgepimpt, der so nie stattgefunden hat. Auch eine kapriziöse Verlegerin - möglicherweise Ulla Unseld-Berkéwicz vom Suhrkamp-Verlag - taucht am Rande auf.
Diese literarischen Bezüge führen auf Nebenpfaden in die Debatte um Ernst Noltes Stalin-Hitler-Kausalitäts-These, Walsers Auschwitzkeule und um die Frage jüdischer Identität. Es ist also unzweifelhaft, dass hier eine Einladung zur Spurensuche für Insider ausgesprochen und zwischen Leipzig und Berlin ein weites kultur-politisches Spektrum der letzten 35 Jahre angetippt wird. Die verklausulierte Botschaft des Ich-Erzählers Dessauer lautet: alles mehr Schein als Sein, mehr Symbol als Substanz!
https://www.kiwi-verlag.de/buch/maxim-biller-der-falsche-gruss-9783462000825

Michael Farris Smith: In fremden Händen ****
Originaltitel: The Hands Of Strangers (USA 2011)
aus dem amerikanischen Englisch von Jürgen Bürger
Ars vivendi Verlag (Cadolzburg 2021)
ca. 200 Seiten, 18,00 Euro
Der Fall des belgischen Mörders, Sexualstraftäters und „Mädchenhändlers“ Marcel Dutroux ging in späten 1990er Jahren durch die Medien. Er wurde zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Die damals dreijährige Maddie McCann ist seit dem Mai 2007 aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwunden. Ihre Eltern suchen bis heute nach der Tochter.
Solche Kriminalgeschichten mögen der Anstoß gewesen sein, dass sich Michael Farris Smith in seinem Debütroman mit diesem Thema befasste. Der US-Amerikaner wohnhaft in Columbia, Mississippi, konzentriert sich bei seinem knappen Text, der eher den Charakter einer Novelle hat, auf die Perspektive der verzweifelten Eltern, nicht auf die des Opfers oder des Täters oder der ermittelnden Behörden. Als Schauplatz hat er die Großstadt Paris gewählt, was wohl damit zusammenhängt, dass er selbst eine Zeitlang in Genf und Paris lebte.
Farris Smith erzählt von dem französisch-amerikanischen Ehepaar Estelle und Jon, die nach ihrer Tochter Jennifer suchen, die vor etwa zwei Monaten bei einem Schulausflug im Musée d’Orsay verschwunden ist. Sie haben Plakate und Flyer gedruckt, die sie an vielen öffentlichen Plätzen aufhängen und verteilen. Doch was macht die lange Erfolglosigkeit mit den beiden? „Der leere Platz“ (man vergleiche den gleichnamigen Debütroman von Marion Karausche) in Jennifers Kinderzimmer stellt auch die beiden Erwachsenen auf eine Probe. Gibt es noch Wunder? Soll man daran glauben? Wie verändert sich das Gemütspendel zwischen Hoffnung und Verzweiflung? Muss man nach Ablenkungen suchen? Hält die Beziehung den psychischen Belastungen stand?
Daraus zieht Farris Smith die Spannung seines Textes, und er tut das mit einer sehr nüchternen Prosa, die - nicht nur wegen des Schauplatzes - an Hemingway erinnert, die aber wegen ihrer ethischen Fragestellungen auch auf Albert Camus verweisen kann.
Die finale „Lösung“ - sie setzt erst im letzten Zehntel der Novelle ein - soll hier nicht verraten werden. Es ist aber fast zwangsläufig, dass Menschen aus solchen existenziellen Situationen verändert herausgehen. Farris Smith findet dafür das Bild der „Schatten vor ihnen“, der „Silhouetten“ als „flüchtiger Blick auf das, was sie einmal waren“.
Der ars vivendi Verlag hat schon mit „Desperation Road“ (2017/18) den Autor für deutsche Leser schmackhaft gemacht, nun ist auch sein schriftstellerischer Auftakt mit europäischem Ambiente in einer trefflichen Übersetzung verfügbar.
https://arsvivendi.com/Buch/Startseite/9783747203224-In-fremden-Haenden

Marion Karausche: Der leere Platz (Roman) ****
Kein & Aber (Zürich / Berlin 2021)
271 Seiten, 22,00 Euro
Eigentlich eine perfekte deutsche Familie: die Eheleute Marlen und Martin Lorenz mit ihren beiden Kindern Kai und Amy. Sie leben privilegiert in Marokko, weil Martin dort einen gut bezahlten Job bei einer großen Firma hat. Marlen bleibt Zeit für interessante Hobbys (Reiten, Tauchen), weil sie sich eine einheimische Haushaltshilfe leisten kann. Die Kinder sind strebsam, intelligent und fröhlich, sie werden an einer elitären Privatschule unterrichtet, wachsen drei- bis viersprachig auf. Mit den Worten der Hauptperson Marlen: „In ihrem Leben, dachte sie oft zufrieden, stimmte alles“.
Dann aber fällt ein dunkler Schatten in die aufgeräumte Idylle: der 18jährige Kai kündigt an, mit Freunden eine Europareise zu unternehmen - von der zunächst nicht zurückkommt. Erst nach drei Monaten meldet er sich wieder, er habe die Zeit für sich gebraucht. Jetzt will er in Mainz studieren, überschreitet aber dort schnell die erlaubte Abwesenheitsquote. Die nächste E-Mail kommt aus Peru mit rätselhaften Substantiven: „Erwachen nach einem lebenslangen Schlaf … Wiedergeburt und … Befreiung“. Er habe dort bei Schamanen im Urwald gelebt und Gott gesehen!
Nun bricht endgültig das Motiv vom verlorenen Sohn in den Roman, er ist zwar zurückgekommen, aber als Fremder. Die Situation verschärft sich, als er wenige Tage später sein Auto mit Benzin abfackelt und in die Notaufnahme der Psychiatrie eingeliefert wird. Es folgen Wochen in der geschlossenen Station; die Diagnose der Ärzte lautet: schizophrene Psychose. Ab diesem Moment erleben wir den verzweifelten Kampf einer Mutter, die ihrem Sohn helfen, ihn begleiten und gleichzeitig nach eigener Schuld sowie nach erblichen Belastungen in der Vergangenheit der Familie suchen will.
Wer eine solche Geschichte so authentisch und so packend erzählt, muss alles selbst erlebt haben. Es ist deshalb nachzuvollziehen, dass die Autorin drei Schutzmauern gegen literarischen Voyeurismus eingezogen hat: sie schreibt unter einem Künstlernamen (die Karausche ist ein Karpfenfisch), sie hat Namen und Orte geändert und sie vermeidet die Ich-Erzählweise.
Dennoch wird man als Leser von Wucht der Ereignisse erfasst, gegen diesen Roman ist Juli Zehs vorletztes Werk „Neujahr“, das mit ähnlichen Psycho-Motiven arbeitete, ein laues Lüftchen. Beeindruckend für ein spätes Roman-Debüt auch die schnörkellose Sprache im nüchternen epischen Präteritum fernab von Kitsch und Larmoyanz. Traurig, aber wahr: die großen Romane entstehen aus Katastrophen oder existenziellen Krisensituationen - wenn man noch die Kraft hat; alles zu Papier zu bringen.

Interview mit Marion Karausche
Nürnberg, 28.9.2021
Frau Karausche, im Zentrum ihres Romans steht die schwere psychische Krankheit eines jungen Mannes und die Frage, wie man damit umgehen kann. Er selber deutet manchmal an, dass er eher die „Normalen“ als die „Verrückten“ empfindet.
Die Grenzen sind verschwommen, sie sind unterschiedlich in verschiedenen Kulturen, es ist immer eine Frage der Perspektive, der Mehrheit und Minderheit.
Seine Mutter Marlen äußert an einigen Stellen Kritik an psychiatrischen Behandlungsmethoden und an rechtlichen Regelungen.
Das war eigentlich der Hauptgrund, dieses Buches zu schreiben, die Geschichte soll ein Aufhänger sein, um ein Thema in den Vordergrund zu rücken, das gerne unter den Teppich gekehrt wird. Ist das Recht, jemandem zuzuschauen wie er an seiner Psychose zugrunde geht, abgeleitet vom Recht auf körperliche Integrität, wirklich noch zu vertreten? Bei einer Schizophrenie muss man feststellen, dass der Betroffene unfähig ist, seine Krankheit noch selbst zu erkennen. Ein Schizophrener ist fest überzeugt, dass er gesund ist, dass er jedoch das Opfer einer Verschwörung ist.
Was heißt das konkret?
Zum einen müssen die Rechte der Eltern gegenüber den Rechten eines Betreuers gestärkt werden. Es kann nämlich sein, dass der Patient aus der Klinik entlassen wird, ohne dass die Familie davon erfährt, dass er dann hilflos in die Freiheit stolpert, was nicht selten aufgrund der Aussichtslosigkeit des Obdachlosenlebens zum Selbstmord führt. Außerdem ist es dringend, dass sich einige Gesetze ändern: die Richter entscheiden über den Patienten, sie sind aber keine Ärzte. Ein Arzt muss mitentscheiden, ob der Patient überlebensfähig ist, wenn er wieder in die Freiheit entlassen wird. Wenn man von Dämonen im Kopf beherrscht wird, muss die grundgesetzlich garantierte persönliche Freiheit etwas anders definiert werden. Wer in seinem Kopf die Aufforderung hört „Spring von der Brücke!“ muss leider in seiner Freiheit beschränkt werden. Aufgrund der hässlichen deutschen Vergangenheit ist dieses Thema aber sehr schwierig und belastet.
Welche Bedeutung hat für den verlorenen Sohn Kai im Roman die Religion, ein Glaube - oder ist das nur eine Ersatzdroge?
Wenn man in einer Psychose steckt, verliert man seinen normalen Anker, z. B. die Familie. Die Flucht zur Religion, zu Schamanen ist die verzweifelte Suche nach einem Halt.
Die Parallelen zwischen der Mutter im Roman und der Autorin liegen natürlich auf der Hand. War das Schreiben des Romans eine Art Trauerarbeit und Selbstbefragung? Wieviel Mut gehört dazu, diese Geschichte ungeschminkt zu erzählen?
Es ist nicht ausschlaggebend, wer hier wirklich betroffen ist. Sobald man sich mit diesem Thema befasst - und das kann auch sein, wenn bei Bekannten so ein Fall auftritt -, braucht man einen Weg, sich damit auseinanderzusetzen. Der Mut kommt dann von alleine, weil das Schreiben ein Schrei der Verzweiflung ist. Das Manuskript entstand in kurzen Episoden über ein Dreivierteljahr. Man muss jeden Tag an das Buch denken und dann am Computer Phasen des Schreibens einlegen. Der zweite Teil war die Arbeit mit dem Verlag, die ungefähr noch einmal so lange gedauert hat.
Das Ende des Romans ließe sich als optimistisch für den Sohn und tragisch für die Mutter deuten. Ist diese Beobachtung falsch?
Die Mutter entdeckt in letzter Sekunde eine Botschaft ihres zweiten Kindes (Amy), für das sie dableiben muss. Wer kämpft, hat noch nicht verloren! Mir war sehr wichtig, dass das Buch - auch angesichts der großen Zahl von Betroffenen - mit einem Hoffnungsschimmer endet.
Welche Reaktionen bekommt man als Verfasserin bei einem so sensiblen Thema?
Erstaunlich viele und sehr private Reaktionen; bei der ersten Lesung in Köln kamen zahlreiche Zuhörer nachher auf mich zu, und erzählten gerührt, dass sie ähnliche Erfahrungen machen mussten.
Wie schafft man es, sein Debüt-Manuskript bei einem so renommierten Verlag (Kein & Aber) unterzubringen?
Es ist ein Teil Glück, dass ein Manuskript wahrgenommen wird. Wichtig war auch das Thema, das die Verantwortlichen im Verlag interessiert hat.
Sie wohnen nun seit etwa einem halben Jahr in Nürnberg. Ist das die provinzielle Alternative zu einem bisher sehr weltläufigen Leben?
Es ist eine sehr wohltuende Abwechslung nach chaotischen Reisen und Aufenthalten in unruhigen Ländern. Ich fühle mich in Nürnberg sehr wohl, ich genieße die Natur, die Radwege und Wanderwege. Ich hatte immer das Klischee, dass die Deutschen kalt und steif sind. Das muss ich jetzt schon revidieren.

Klaus Modick: Fahrtwind (Roman) ****
Kiepenheuer & Witsch (Köln 2021)
ca. 195 Seiten, 20,00 Euro
Was so alles passieren kann, wenn man auf ein altes Reclam-Bändchen stößt: bei Plenzdorfs Edgar Wibeau war es Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ - noch dazu ohne Titelblatt -, das ihm während der Betrachtung seiner neuen Leiden in der DDR der 70er Jahre erstaunliche Parallelen aufzeigte. Beim Ich-Erzähler in Klaus Modicks neuen Roman ist es Joseph von Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts“, das ihn an die einstige Studentenzeit vor knapp 50 Jahren in Hamburg erinnert, an ein Proseminar mit dem Titel „Liebe und Ehe in Romanen der Romantik“ und an den damals gescheiterten Versuch die alte Geschichte zu aktualisieren. „Warum es also heute nicht noch einmal probieren?“
So entwickelt sich die Geschichte vom Vater, dem Chef der Installationsfirma Müller (!), und dem langhaarigen Sohn, der ziellos vor sich hin studiert, auf der Gitarre Lieder komponiert und schließlich zu dem Entschluss kommt, er müsse „weg von hier“ - am besten „südwärts“.
Zwei Frauen (Mutter und Tochter) nehmen den Tramper an einer Autobahnraststätte mit, er landet tags darauf verschlafen im Schlosshotel Lindenhof nahe bei Wien. Die ältere Dame - Josephina Carlotta Gräfin von Lindenhof - ist dort die Hoteldirektorin und bietet ihm einen Job als musikalischer Alleinunterhalter bei sogenannten Verwöhn-Wochenenden an. Der Troubadour ist vom Honorar beeindruckt - und von der möglichen Nähe zur sehr gut aussehenden Tochter. Im Schlossgarten findet er außerdem bewusstseinserweiternde Pilze (die Österreicher sagen „narrische Schwammerln“), die ihm die Unterscheidung von Traum und Leben schwer machen.
Damit startet im Abstand von etwa 150 Jahren eine postmoderne Taugenichts-Geschichte, in der sich Eichendorff-Gedichte mit Pop-Songs der 1970er Jahre mischen, in der aus der Postkutsche ein Fiat 500, aus Guido und Leonhard das Easy-Rider-Duo Billy und Wyatt, sowie aus dem Schloss bei Rom die Villa Maria Iona (!) wird. Danach landet der mit Woodstock sozialisierte Liedermacher noch in der Stipendiaten-Villa Massimo, wo der große Poet Rolf-Dieter Denkmann (!) radikale Thesen verbreitet und seine Mitbewohner als „hirnlose Schwätzer“ und „korrupte Schreiberlinge“ tituliert. Die Prager Studenten und Blasmusiker, die der Taugenichts auf dem Rückweg nach Wien trifft, sind nun Mitglieder der Band „The Students“; der Ich-Erzähler darf gleich als Ersatz-Gitarrist einsteigen und seine Eigenkomposition „Gestern, heute, morgen“ an Bord des Donau-Dampfschiffs vermarkten.
Klaus Modick verpflanzt den Lektüre-Klassiker mit viel Phantasie und Ironie aus der deutschen Romantik in die Hippie-Ära und folgt dem Original sogar mit einem - nur geträumten - Happy End. Im Bereich der Musik würde man von einer gelungenen Cover-Version sprechen - ähnliches wäre zu erwarten gewesen, wenn die Gruppe Jefferson Airplane 1970 Lieder von Franz Schubert neu vertont hätte. Der Leser mit Toskana-Migrationshintergrund findet das volle Vergnügen bei der Doppel-Lektüre des echten Eichendorffs und der Modick-Adaption, am besten in dieser Reihenfolge!
https://www.kiwi-verlag.de/buch/klaus-modick-fahrtwind-9783462001303

Rolf Gröschner / Wolfgang Mölkner: Kants Doppelleben ****
Verlag Karl Alber (Freiburg / München 2021)
122 Seiten, 24,00 Euro
Keine Sorge: es handelt sich hier nicht um einen Enthüllungsroman über das Privatleben des nie verheirateten und vermutlich jungfräulich gestorbenen Philosophen. Die beiden Nürnberger Autoren wollen nur die Gedankenwelt des „philosophisch Unsterblichen“ durchleuchten und konstruieren dazu acht fiktive Audienzen in der Bibliothek seines Hauses in Königsberg, deren Ablauf von dem Diener Martin Lampe streng geregelt wird. Immanuel Kant tritt dabei stets in einer Doppelrolle als Vernunftmajestät und Sinnenmajestät auf, jedem Gast wird als Hilfsmittel gegen Gebühr eine Transzendentalbrille angeboten. Es erscheinen - in chronologischer Ordnung - Martin Luther, Jean-Jacques Rousseau, Charles Darwin, Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Albert Einstein und Hannah Arendt.
Die Gespräche (jeweils knapp zehn Seiten) verlaufen teilweise im emotionalen Wettstreit, teilweise schlüssig argumentativ, teilweise mit konsensualem Ziel - fast wie in heutigen Philosophie-TV-Talk-Formaten von Richard David Precht oder Peter Sloterdijk.
Am Ende dürfen sich noch zwei weitere Unsterbliche (Platon und Aristoteles) ins Gespräch über politische Ethik mischen, bis schließlich auch die beiden Verfasser in das Talk-Forum aufgenommen werden. Dabei erläutern sie die Intention ihres Planspieles: sie wollten dem Philosophen, der „den historischen Höhepunkt der Aufklärung markierte“, eine Gelegenheit geben, seine Thesen im Dialog mit Denkern des 16. - 20. Jahrhunderts zu verteidigen. Dass sie zu dieser Gesprächsreihe die Herren Hegel und Marx (noch) nicht eingeladen haben, wird vom Protagonisten dankbar vermerkt, diese beiden geisteswissenschaftlichen Schaukämpfe hätten aber dem heutigen Leser weitere Denkanstöße vermittelt.
Ähnlich wie in Ilona Jergers Roman „Und Marx stand still in Darwins Garten“ entwickelt sich hier ein unterhaltsames szenisches Arrangement, fernab von trockenem Proseminar-Stoff mit Dozenten-Monolog. Daher gilt für diese originelle Publikation der kategorische Imperativ: Lesen und/oder bei der nächsten Einladung mit verteilten Rollen nachspielen!
https://www.herder.de/philosophie-ethik-shop/kants-doppelleben-kartonierte-ausgabe/c-27/p-20845/

Heinz Strunk: Der goldene Handschuh ****
rororo (Reinbek bei Hamburg 2019, 7. Aufl.)
Originalausgabe 2016
ca. 250 Seiten, 11,00 Euro
Wie tief will man in menschliche Abgründe schauen? Es war die Literatur des Vormärz und Georg Büchners „Woyzeck“, der uns - auf der Basis einer wahren Begebenheit - einen Antihelden vorführte, der - gesellschaftlich diskriminiert und marginalisiert - in seiner Verzweiflung zum Mörder seiner geliebten Marie wird. Dahinter stand die Frage der deterministischen Anthropologie „Was ist das, was in uns hurt, lügt, stiehlt und mordet?“ - übrigens auch eine Frage des an den Wendungen der Geschichte der Französischen Revoliution verzweifelten Danton.
Ein gewagter Sprung führt zu dem Roman von Heinz Strunk, der uns in „Der goldene Handschuh“ schon mit dem einführenden Zitat von Jürgen Bartsch eine ähnliche Frage stellt („Warum muss es überhaupt Menschen geben, die so sind?“) und dann auf 250 Seiten die Untiefen des Hamburger Trinkermilieus erkundet, wo auch der Mehrfachmörder Fritz „Fiete“ Honka ab 1971 sein Unwesen trieb. 1976 wurde Honka wegen Mordes an vier Frauen zu lebenslanger Haft und zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt. Ein ärztliches Gutachten aus dem Jahre 1981 sprach von einer hochabnormen „Persönlichkeit mit sexueller Devianz, der in Freiheit erneut dem Alkohol verfallen und sich älteren Frauen in der jahrelang praktizierten Art zuwenden würde“.
Im Gegensatz zu Büchner leistet Strunk aber keine gesellschaftskritischen Analysen, kein differenziertes Täter-Psychogramm, er begnügt sich mit einer manchmal unterhaltsamen, manchmal abstoßenden Dokumentation, die nicht einmal auf Elemente der Ironie verzichtet.
Was zunächst als scheinbar launige Reportage aus dem Trinkermilieu beginnt, nimmt eine beklemmende Wende und führt schließlich zu vier toten Frauen, die Honka in seiner Wohnung (Zeißstraße 74) auf bestialische Weise ermordet und in einer Dachschräge entsorgt hat. Zartbesaitete Leser sollten sich warm anziehen, kritische Leser werden versuchen, dem Autor spekulativen Umgang mit Gewalt und eine Art literarischen Voyeurismus vorzuwerfen. Doch das erscheint unzutreffend, denn Strunk agiert keineswegs als Sensationsreporter, sondern eher als kundiger Milieubeobachter, der seine Figuren nicht an den Pranger stellt und es dem Leser überlasst, welche Schlüsse aus diesen Ereignissen zu ziehen sind. Der Absturz von Honka verläuft auch nicht geradlinig sondern enthält eine Phase der Besserung, wo er als Wachmann arbeitet und von seinem bisherigen Leben wegkommen will. Die erfolglose Anmache bei der Putzfrau Denningsen führt aber wieder in die alte Sucht und in den alten Trieb: „jetzt will er Rache nehmen“. Jetzt will er so berühmt werden wie Jack The Ripper!
Als besondere Kunstfigur hat Strunk noch eine zweite Personen- und Handlungsebene eingebaut: die wohlhabende Hamburger Reederfamilie von Dohren mit drei Generationen von Wilhelm Heinrichs (WH 1 bis 3). Auch hier kann man Kaputtheit besichtigen, freilich auf einem ganz anderen gesellschaftlichen Niveau, jedoch ebenfalls mit Zufluchten in das berüchtigte Lokal.
Ein rauschhafter, trostloser und bedrückender Roman, eine Besichtigung von menschlichen Ruinen und eines Milieus der Verzweiflung.
https://www.rowohlt.de/buch/heinz-strunk-der-goldene-handschuh-9783499271274

Heinz Strunk: Fleisch ist mein Gemüse.
Eine Landjugend mit Musik ****
Rowohlt Taschenbuch Verlag (Reinbek bei Hamburg 2019, 36.Aufl.),
Originalausgabe: 2004
ca. 255 Seiten, 10,00 Euro
Heinz Strunks (alias Jürgen Dose) autobiografische Erzählung über seine Zeit als Saxofonist bei der Tanzband Tifannys, mit der er in den Jahren 1985 - 1997 im norddeutschen Raum rund um Hamburg bei Schützenfesten, Faschingsbällen, Hochzeiten und Geburtstagen als Saxofonist auftrat, ist mittlerweile ein Klassiker der Live-Musik-Satire geworden. Niemand hat vor oder nach ihm jene besondere Atmosphäre aus Landgasthof, fettem Essen und zügellosem Trinken, aus tragischen Musik-Amateuren und kaputten Pseudo-Gaststars, aus totgenudelter Stimmungsmusik zwischen Drafi Deutscher und Marius Müller-Westernhagen, aus Verbal-Erotik, Anal-Radikalismus und verschwitzter Nachtarbeit so treffend und ironisch niedergeschrieben.
Heinz, der aus Harburg, dem „langweiligsten Ort der Welt“ stammt, hat Probleme mit seiner Akne, mit einer pflegebedürftigen Mutter, mit fehlenden beruflichen Perspektiven und mit wenig Erfolg bei den Mädchen. So pendelt er zwischen Depressionen, Drogenexperimenten, Sozialhilfe und dem Traum von einer Karriere im Pop-Business, bis er bei Tiffanys einen festen Platz findet, der die gröbsten materiellen Sorgen beendet und die drohende Langeweile zu Hause wenigstens am Wochenende mildert.
So entsteht im Laufe der Zeit eine Art Hassliebe zu dem Mucker-Job und am Ende die Frage, ob man das, was man in zwölf Jahren Tanzmusik erlebte, „nicht auch in einem halben Jahr hätte durchziehen können“. Doch der Sinn dieses Lebensabschnitts enthüllt sich überdeutlich: er hat wenigstens einen tollen Roman darüber geschrieben!
Nicht jeder hat(te) das Vergnügen in einer Tanzband, Cover-Band oder Oldie-Band an solch vergnügten Abenden teilzunehmen, aber sicher jeder hat schon einmal als Gast oder Gastgeber den diskreten Charme dieser Veranstaltungen miterleben dürfen. Ersteres trifft für Sven Regener zu, der anmerkte, dass einem jeder leid tue, „der das Buch von Heinz Strunk nicht gelesen hat“. Zur zweiten Gruppe gehört wohl Eckhard Henscheid, der Heinz Strunk unverdrossen in einer Liga mit Karl Valentin, Gerhart Polt, Helge Schneider und Heino Jäger ortet (vielleicht sollte man auch noch die Namen Frank Schulz, Olli Dittrich und Thomas Kapielski ergänzen).
Abschließend: der Titel ist eine dezidierte Aussage des Tiffanys-Keyboarders Jens anlässlich einer Bandmahlzeit vor dem Auftritt im Landgasthof Peters in Klein Eilstorf!
https://www.rowohlt.de/buch/heinz-strunk-fleisch-ist-mein-gemuese-9783644400313

Jörg Fauser: Rohstoff (Roman) *****
Diogenes (Zürich 2019), Erstausgabe: Berlin 1984
ca. 350 Seiten, 24,00 Euro
In einem Interview erläuterte Jörg Fauser, er könne nur über etwas schreiben, was er selbst erlebt habe. Insofern ergibt sich hier die Vorbemerkung, dass zwischen Harry Gelb, der Hauptperson dieses Romans, und dem Autor große Überschneidungen bestehen, dass man aber das Buch nicht als bloße Autobiografie lesen sollte. In seinem eher kurzen Leben (1944 - 1987) hat Fauser aber eine Menge erlebt, der Rohstoff ist also vorhanden, es stellt sich nur die Frage nach der literarischen Formung. Der Roman beschränkt sich auf die Jahre 1967 - 1973, in denen der Ich-Erzähler zahlreiche Schauplätze aufsucht (u.a. Istanbul, Berlin, Göttingen und Frankfurt) und vor allem Erfahrungen in diversen „Szenen“ sammelt: die harte Drogenszene, die politische Linke mit Kommunarden und Hausbesetzern, die Kneipen-Trinker-Szene und natürlich den Avantgarde-Underground-Literaturbetrieb. Der Beruf des Schriftstellers ist Harry Gelbs Lebensziel, denn „unter allen Dächern lebten Geschichten, die darauf warteten, geschrieben zu werden“. Dieses Ziel verfolgt er mit seiner Schreibmaschine Olympia Splendid 33 und mit einem konsequenten Wankelmut: manchmal denkt er, er müsse mit diesem „Unsinn“ Schluss machen und einen Job suchen, der ein Überleben sichert. Das führt ihn dann (unter anderem) zu einer Aushilfsstelle bei der Deutschen Bundesbank, zu einer Tätigkeit bei einem Sicherheits- und Bewachungsdienst und zu einer Anstellung als Gepäckarbeiter am Frankfurter Flughafen. Zwischendurch formuliert er aber doch wieder das Programm, es als freier Schriftsteller zu schaffen, obwohl doch die guten Bücher alle schon geschrieben sind, die Avantgarde brotlos ist und sich in abwegigen Experimenten wie Cut-Up-Literatur ergeht. Harry Gelbs Karriere endet nach zwei Buchveröffentlichungen („Eisbox“ und „Stamboul Blues“) vorläufig mit einer traurigen Lesung beim katholischen Jugendbildungsklub in Montabaur. Genauso polarisierend entwickelt sich seine Lebensphilosophie in diesen Jahren: während er am Anfang im Istanbuler Junkie-Milieu noch formuliert „das Leben war ohnehin sinnlos“, sieht er am Schluss nach dem Rauswurf aus einer Frankfurter Bahnhofskneipe einen Riss im Asphalt aus dem ein Grashalm sprießt und denkt „Wenn das so ist … kannst du auch aufstehn!“
Eine prominente Nebenrolle spielen in dem Roman auch Harry Gelbs Beziehungen zu Frauen (Sarah, Bernadette, Anita und noch ein paar mehr), die jedoch meist in einer Sackgasse enden, von Bernadette beispielhaft beschrieben: „Ich kann nicht mit jemand leben, der sich so treiben lässt“. Auch in der linken Szene findet Harry keine Heimat und entdeckt dann nach seinem Drogen-Ausstieg eher die Kneipe als Asyl, Freihafen und Zuhause (wie das schon Eckhard Henscheid in seiner alkoholgeschwängerten Trilogie „Geht in Ordnung - sowieso - genau“ herausgefunden hat). Gerne kann man „Rohstoff“ auch als Schlüsselroman lesen, in dem einige bekannte Namen der linken Literatur- und Polit-Szene der 68er Jahre anonym auftauchen (im Nachwort bemüht sich Matthias Penzel um Auflösungen), oder als intertextuelle Fundgrube (Burroughs, Chandler, Dostojewski, Ambler, Fallada, Greene, Lowry, Bukowski usw.). Vor allem aber ist „Rohstoff“ ein halb-tragischer Entwicklungs- und Schelmenroman ein faszinierend-schleppender Großstadt-Blues, der sich literarisch liest und doch völlig unliterarisch ist. Gerade das macht den Reiz und die hohe Qualität von Fausers Beobachtungen aus.
https://www.diogenes.ch/leser/titel/joerg-fauser/rohstoff-9783257070347.html

Ludwig Fels: Dou di ned o. Gedichte ***
ars vivendi (Cadolzburg 2021)
ca. 110 Seiten, 15,00 €
Ludwig Fels ist am 11.1.2021 im Alter von 74 Jahren gestorben. Somit ist der folgende Text nicht nur eine Rezension sondern auch ein Nachruf auf einen bedeutenden fränkischen Schriftsteller.
Auf dem Buchcover leuchtet als letzter Buchstabe des Titels „Dou di ned o“ ein höchst symbolisches Stoppschild: als würde Ludwig Fels bei seiner literarischen Reise innehalten und wieder die Wurzeln seiner sprachlichen Sozialisation besichtigen. In Treuchtlingen wurde er 1946 geboren, zog dann 1970 nach Nürnberg, wo er erste dichterische „Anläufe“ (so der Titel seines Debüt-Gedichtbandes aus dem Jahre 1974) nahm, um dann mit dem Roman „Ein Unding der Liebe“ (1981) als Kulturpreisträger der Stadt Nürnberg den literarischen Durchbruch zu schaffen und eines seiner Lebensthemen zu finden. 1983 verlegte er seinen Wohnsitz nach Wien, gab aber den Kontakt nach Franken nie ganz auf.
Das Ergebnis seiner Rückbesinnungen - Fels nennt es ein „Lauschen in die Vergangenheit“ - ist eine Zusammenstellung von 85 kurzen Gedichten in fränkischer (genauer: südwest-mittelfränkischer) Mundart, eingeteilt in acht Kapitel von B wie Boesie bis U wie Uhrgnall. Dabei erinnert sich Ludwig Fels an seinen Geburtsort „Dreichdling, Kaff der goudn Hoffnung“, an die hart arbeitende Mutter, an Schauplätze rings um die Altmühl und an Freunde des Jahrgangs 1946. Es folgt: „Nach Nämberch bin i ganga wechn die Fabrign“. So wird Fels zum engagierten Arbeiterdichter, ein Etikett, das er heute ungern hört. In Nürnberg lernt er auch Fitzgerald Kusz kennen, den elder statesman der modernen fränkischen Lyrik, dem er nun eine Ode widmet: „Ach ich liebe seine Schbrache / dieses frängische Genache“.
Trotz aller Lakonik und Nüchternheit ist der Band eine Liebeserklärung an die alte Heimat, erfreulicherweise ohne tumbe Volkstümelei und klischeehafte Nostalgie, durchsetzt mit einer typisch fränkischen Blues-Stimmung: „Brauch blouß a Balladn hörn / und scho grein i Rodz und Wasser“. Oder an anderer Stelle: „Am liebschden moch i aber doch des Frangenword / weil i bin scho viel dslang vo Frangn fodd“. Umgekehrt darf man Ludwig Fels fragen, warum er seit fast vierzig Jahre in Wien lebt, wo er doch so abwägend schreibt: „In Wien gibds ka Bradwurschdsulz / kann Bressack und kann Frangenwein / blouß Schnidsel / und dai san zum Schbein“.
Bei Ludwig Fels werden Mundartgedichte nicht zur Alterstorheit sondern zu einem idealen Medium für nur auf den ersten Blick banal erscheinende Lebensweisheiten: „Des Leem, des is a Falle / mit einem Dod fier alle“. Und auf den Grabstein kann sich der bekennende Franke nun in treffender Dialekt-Ik schreiben lassen: „War hald dou / ko mer sagn / odä a ned“. Im Schlusssatz seines unaufgeregten Gedichtbandes steht ein nun leider endgültiges Fazit: „Wos i no sogn wolld / fälld mer nemmer ei“.
https://arsvivendi.com/Buch/Startseite/9783747201947-Dou-di-ned-o
Keineswegs Krimis: drei Mörder, drei Motive, zwei Todesurteile
Leonhard, Frank: Die Ursache
(Erzählung, 1915)
Aufbau Verlag Digital
In Buchform nur antiquarisch erhältlich
Albert Camus: Der Fremde
(Erzählung 1940/1942)
rororo , 9,00 Euro
Peter Handke: Die Angst des Tormanns beim Elfmeter
(Erzählung, 1968)
Suhrkamp Taschenbuch, 7,00 Euro

Anton Seiler, ein vermögensloser Dichter
Würzburg, Berlin 1907
erwürgt seinen früheren Lehrer Mager
Er erinnert sich an die unmenschlichen Demütigungen während der Schulzeit, er wollte sich eigentlich mit dem Lehrer versöhnen
wird zum Tod durch Hinrichtung verurteilt
Suche nach den Ursachen des Verbrechens: das autoritäre Erziehungssystem, das kapitalistische Wirtschaftssystem, Kritik am Justizsystem (Todesstrafe)

der Angestellte Meursault als Ich-Erzähler
Algier
erschießt einen Araber, der vorher seinen Freund Raymond bedroht hatte
Schuld an allem hat nur die blendende Sonne (?); er ist ein anständiger Mensch, der eine Minute lang die Herrschaft über sich verloren hat - oder: vorsätzlicher Mord eines seelenlosen Menschen
Die Geschworenen verhängen ein Todesurteil
Das alltägliche (sinnlose?) Leben führt zu Überdruss, zur Frage „Warum?“, zur Erkenntnis der „zärtlichen Gleichgültigkeit der Welt“.

Josef Bloch, Monteur, früher ein bekannter Tormann
Wien, Grenzstadt im Süden Österreichs
erwürgt die Kinokassiererin Gerda T.
Nach der ersten Nacht mit ihr „störte ihn alles immer mehr … Plötzlich würgte er sie.“
liest in der Zeitung von den polizeilichen Ermittlungen
Die Demonstration einer Verstörtheit, eines schizophrenen Bewusstseinszustands, einer Unfähigkeit, die Signale der Umgebung richtig zu fassen

Karl Bröger: Flamme (Gedichte)
Eugen Diederich Verlag (Jena 1920)
ca. 95 Seiten, nur antiquarisch erhältlich
Vor genau 100 Jahren ist im Eugen Diederichs Verlag (Jena) ein schmales Bändchen mit zwanzig Gedichten und drei Versspielen des Nürnberger Schriftstellers Karl Bröger unter dem Titel „Flamme“ erschienen. Der Biograf Gerhard Müller hält es für sein literarisch bedeutendstes Buch, Brögers ältester Sohn Friedrich, der von 1948 bis 1967 als Chefdramaturg an den Städtischen Bühnen Nürnberg arbeitete, bemerkte im Rückblick, dass sein Vater „seine glücklichste und fruchtbarste Zeit … in der Weimarer Republik, in der kurzen Spanne eines relativen Friedens“ erlebte. Den Literaturwissenschaftlern Herbert und Elisabeth Frenzel ist die „Flamme“ in ihrem Standardwerk „Daten deutscher Dichtung“ eine ausdrückliche Erwähnung wert, den Eingang in Kindlers Neues Literatur-Lexikon hat Karl Bröger jedoch nicht geschafft.
Auf der Vorderseite erhebt sich unter dem Titel eine nackte Frau aus der Feuersbrunst des 1. Weltkriegs, eine Illustration des Gedichts „Venus und der Tod“, in dem es heißt: „Auf dem Tisch ein Weib / reckt sich in zierlicher Schale … / ruhig steht die Gestalt / lockend die Hand an der Hüfte. / Über alle Grüfte / herrscht der Liebe Gewalt.“ Damit ist auch das zentrale Thema dieses Gedichtbandes angesprochen: es geht um die Überwindung von Krieg und Gewalt durch Liebe, Leben, Freiheit und Mitmenschlichkeit. Oder wie es in „Heimkehr und Gelöbnis“ heißt: „Der Krieg sei tot! Es lebe jedes Streben, / das alle fördert zu erhöhtem Leben!“
In der poetischen Analyse des Krieges, den Bröger nach einer Verwundung nur bis zum Dezember 1914 als Soldat an der Westfront miterleben musste, erweist sich der Autor als national denkender Idealist, gleichzeitig als sozialer Humanist, der den deutschen Soldaten das Recht auf Landesverteidigung nicht abstreitet, jede Form von expansiver Aggression aber kritisiert. Charakterisierungen wie das Heer, „das unserer Hüterfaust gewesen“ sei und mit erhobenem Haupt heimwärts ziehe, können natürlich isoliert missverstanden werden; sie führten auch zum Vorwurf einer „Nähe … zur nationalsozialistischen Weltanschauung“ (Alexander von Bormann). Zurecht hat Dieter Schug darauf hingewiesen, dass „national und sozialistisch die innersten Triebfedern“ von Brögers Wesen waren, „aber doch ganz und gar nicht im Sinne jener Partei, die in ihrem Namen beide Begriffe programmatisch verschmolzen hatte“.
Ein besonderer Bestandteil dieses Buches sind drei Versspiele, das heißt szenische Einakter mit lyrischer Sprechweise, die offensichtlich für den Einsatz bei Laienspielgruppen der Jugendbewegung gedacht waren. In dem „Spiel von Schuld und Sieg“ mit der Überschrift „Kreuzabnahme“ konstruiert Bröger ein Streitgespräch zwischen dem personifizierten Krieg und den von ihm Betroffenen. Mit mephistophelischer Schärfe und dem poetischen Ton der deutschen Klassik erklärt der Krieg, dass er nicht aus dem Nichts komme: „mein Wirken wohnt / im Geiste, in der Waffe nicht“.
Damit unterscheidet sich Bröger von seinen expressionistischen Zeitgenossen wie Trakl, Heym oder Stadler ebenso wie von der Dialektik des kapitalismuskritischen Kriegs-Berichterstatters Bertolt Brecht. Bei Brögers Verszeilen denkt man eher an einen hymnischen Prediger, der ein bisschen Frieden für die Menschheit einfordert. Nicht überraschend ist, dass einige der „Flamme“-Gedichte sogar vertont wurden: der ungarische Komponist Erwin Lendvai machte daraus Liedgut für A-Cappella-Chöre.
Die Krisensituation des Jahres 1920 in Deutschland ist gekennzeichnet durch eine zunehmende Unzufriedenheit mit den auferlegten Bedingungen des Versailler Vertrags, durch den von rechtsorientieren Freikorps versuchten Putsch unter der Führung von Wolfgang Kapp und General von Lüttwitz sowie durch die Gründung einer neuen Partei, der NSDAP, im Münchner Hofbräuhaus. Angesichts dieser Entwicklungen grenzt die Brögersche Naturlyrik mit einer „Hymne an einen Baum“ und einer Beschwörung der magischen Waldlandschaft schon fast an Eskapismus: eines Stadtmensch, der mit vierhebigem Trochäus und Kreuzreim im Tornister von seinem Siedlungshäuschen in Nürnberg-Ziegelstein in die Einsamkeit der Natur wandert.
Erst im letzten Gedicht des Lyrikbandes wird ein Thema angeschlagen, das Karl Bröger - eindeutig zu Unrecht - bis heute den Beinamen „Arbeiterdichter“ einbrachte. Unter dem Titel „Sturz der Fabriken“ illustriert er das Ende des Industriezeitalters: „über eine Nacht / sind die Fabriken der flachen Erde gleich gemacht“. Bröger stammt zwar aus einer armen (und bildungsfernen!) Arbeiterfamilie und schließt sich der Arbeiterpartei SPD und der Gewerkschaftsbewegung an, als Redakteur der Fränkischen Tagespost ist er aber eher der Schicht der Angestellten zuzuordnen, als Schriftsteller ist er weit von dem entfernt, was in den 1960er Jahren wieder als Literatur der Arbeitswelt publiziert wurde und als Bewahrer der elaborierten Verssprache der deutschen Klassik hält er es eher mit dem Postulat von Arno Schmidt, das Volk müsse zur Kunst kommen - nicht umgekehrt.
So liest sich Brögers Gedichtband „Flamme“ als vielschichtiges Zeitdokument, als Denkanstoß zu der Frage nach der (Nicht-)Wirksamkeit von Lyrik und der Missverständlichkeit von künstlerischer Sprache, ein Phänomen, das Theodor W. Adorno nach 1945 als „Jargon der Eigentlichkeit“ kritisiert hat. Das Buch ist derzeit nur antiquarisch zu einem Durchschnittspreis von etwa 10 Euro und natürlich auch in gut sortierten Stadtbibliotheken erhältlich.

Karl Bröger, geboren 1886 in Nürnberg-Wöhrd, veröffentlichte 1910 seine ersten literarischen Arbeiten. Nach mehreren Gelegenheitsjobs wird er ab 1910 Redakteur der Fränkischen Tagespost. Schon 1919 erscheint sein autobiografischer Roman „Der Held im Schatten“. Er ist Mitbegründer des republikanischen Reichbanners Schwarz-Rot-Gold, wo sein Gedicht „Vaterland, ein hohes Licht“ als Hymne der Organisation genutzt wurde (siehe unten). 1933 kandidiert Bröger (SPD) erfolgreich für den Nürnberger Stadtrat, wird aber von Nazi-Schlägern misshandelt und in das KZ Dachau verschleppt. Nach der Freilassung sucht er eine literarische Nische und schreibt vor allem historische Romane. Er stirbt 1944 an Kehlkopfkrebs. Bei der Totenfeier versuchen NS-Funktionäre ihn als Sympathisanten zu reklamieren: im nationalsozialistischen Deutschland habe seine Sehnsucht ihre Erfüllung gefunden. Die Nürnberger Karl-Bröger-Gesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Erbe des Schriftstellers zu bewahren, im Karl-Bröger-Haus und mit den Adressen Karl-Bröger-Straße, -Platz und -Tunnel ist sein Name verewigt worden.
Karl Brögers Gedicht „Heimkehr und Gelöbnis“ endet mit den folgenden vier Strophen:
Vaterland, ein hohes Licht,
Freiheit glänzt von deiner Stirne.
Von der Marsch zum Alpenfirne
glühen Herzen, wachen Hirne
und die heilige Flamme spricht:
Volk, hab acht!
Brüder wacht!
Eher soll der letzte Mann verderben,
als die Freiheit wieder sterben.
Brüder, schwört euch in die Hand:
Morgenrot um alle Berge!
Ausgetilgt der letzte Scherge!
Freies Leben, freie Särge,
freier Sinn im freien Land!
Volk, hab acht!
Brüder, wacht!
Hell die Augen, heller die Gewissen!
Sonst ist bald das edle Band zerrissen.
Deutscher Mensch, der nie verdirbt:
Eins die Stämme, eins die Auen!
Deutscher Geist in allen Gauen
soll nach einem Ziele schauen,
dass er nicht in Kleinheit stirbt.
Volk, hab acht!
Brüder, wacht!
Groß aus großem Leid uns zu erheben,
muss nach einem Reiche alles streben.
Brüder, lasst uns armverschränkt
Mutig in das Morgen schreiten!
Hinter uns die schwarzen Zeiten,
vor uns helle Sonnenweiten!
Wicht nur, wer die Freiheit kränkt!
Volk, hab acht!
Brüder, wacht!
Deutsche Republik, wir alle schwören:
Letzter Tropfen Blut soll dir gehören!
Literatur zur Endzeitstimmung




Menschen, die in diesen Tagen kontaktlos durch menschenleere Straßen streifen oder die weltweiten Infektionszahlen der Johns Hopkins Universität am Live-Ticker abonniert haben, könnten in eine gewisse Endzeitstimmung verfallen. Auf dem Feld der fiktionalen Erzählung sind einige AutorInnen diesen Schritt schon gegangen und haben sich in den letzten 70 Jahren gefragt: Was passiert, wenn nach der Apokalypse nur noch eine(r) übrig bleibt? Wie verhält sich der Mensch, der ja als soziales Wesen definiert ist, wenn er feststellt, der letzte/der einzige zu sein?
Überwiegend sind es Männer, die als letzte Menschen porträtiert werden; in zwei Fällen handelt es sich um antropophobe Einzelgänger, die sich für intellektuell überlegen halten und für die die neue Situation gar keine echte existenzielle Herausforderung darstellt. Der Ich-Erzähler in Arno Schmidts „Schwarze Spiegel“ (1951) sagt sogar lakonisch: „ach es war doch gut, daß Alle weg waren“. Bei Guido Morselli („Dissipatio humani generis“, 1977) begegnen wir einem eremitisch lebenden Selbstmord-Kandidaten, dem die Einsamkeit einen neuen Spiel-Raum in der leeren Stadt (Zürich) bietet. Für den 40jährigen Lorenz (in Jürgen Domians „Der Tag, an dem die Sonne verschwand“ - 2008) und für den etwa gleichaltrigen Jonas (in Thomas Glavinic‘ „Die Arbeit der Nacht“ - 2006) bedeutet die un-menschliche Situation jedoch eine soziale Katastrophe, ein Herausreißen aus gewohnten Zusammenhängen und Beziehungen. Sie reagieren darauf mit quälerischen Selbstreflexionen und eher ziellosen Erkundungs-Touren (Ist da noch jemand?). Demgegenüber wirkt Anton L. (in Herbert Rosendorfers „Großes Solo für Anton“ - 1976) eher wie das narrative Kunstprodukt eines satirischen Erzählers. Die einzige Autorin in dieser thematischen Reihe beschreibt auch die einzige Frau als letzten Menschen: Marlen Haushofer mit „Die Wand“ (1963) - eindrucksvoll verfilmt mit Martina Gedeck in der Hauptrolle. Etwas aus dem Rahmen der hier vorgestellten Prosawerke fällt Carl Amerys Fantasy(?)-Roman „Der Untergang der Stadt Passau“ (1975). Nach einer Seuche, die höchstens einer von 50 000 Menschen überlebt hat, gibt es noch regional isolierte Personengruppen, die später miteinander in Kontakt treten und um die richtige Strategie einer neuen Welt ringen. Damit liegt Amery am nächsten an der gegenwärtigen Situation.
Über die Hintergründe der Katastrophe gibt es zwar vereinzelte Reflexionen, doch niemals wird eine stichhaltige Erklärung mitgeliefert. Bei Arno Schmidt könnte ein Atomkrieg die Ursache sein, bei Carl Amery ist es eine Seuche als Folge der spätindustriellen Lebensweise, bei Jürgen Domian eine Klimakatastrophe. Die gläserne Wand, die sich bei Marlen Haushofer um die Protagonistin schließt, versteht sich ohnehin nur als symbolisches Konstrukt. Die Zerstörung auf der anderen Seite der Wand wurde als Folge einer Neutronenbombe gedeutet.
In drei Romanen bleiben die letzten Menschen trotz intensiver Suche allein und steuern auf den eigenen Tod oder auf ein offenes Ende hin. Anders bei Arno Schmidt und Jürgen Domian: dort treffen die Isolierten jeweils auf einen zweiten Menschen, der allerdings bald wieder verschwindet. Marlen Haushofers Ich-Erzählerin stößt am Ende des Romans auf einen Mann, den sie aber erschießt, weil er mit dem Beil auf ihren Stier losgegangen ist. Eine weitere Fortpflanzung der verbliebenen Menschheit wird damit unmöglich - für die Hauptperson ist nun das Alleinsein ein selbstbestimmter Akt, nur Tiere bleiben als Bezugsobjekte.
Diese Beobachtung verweist fast zwingend auf ein Phänomen, das diesen Werken gemeinsam ist: nicht die Apokalypse ist das eigentliche Thema sondern das Individuum, das sich auch heute schon als Einzelkämpfer in der Welt des Kapitalismus und Materialismus verstehen kann.
Wer nervlich stabil ausgestattet ist, dem sei als Lektüre empfohlen: Carl Amery für Öko-Utopisten; Jürgen Domian für konventionelle Leser; Thomas Glavinic für „moderne“ Menschen; Marlen Haushofer für sensible (weibliche?) Natur-Liebhaber; Guido Morselli für an sich selbst zweifelnde Philosophen; Arno Schmidt für selbstsichere Zyniker. Dazu darf man gespannt sein, wann der erste Virus-Endzeit-Roman auf den Markt kommt.
Arno Schmidt: Schwarze Spiegel. Suhrkamp, 154 Seiten, 7,00 Euro
Thomas Glavinic: Die Arbeit der Nacht. dtv, 400 Seiten, 10,90 Euro
Herbert Rosendorfer: Großes Solo für Anton. Langen-Müller, 320 Seiten, 15,00 Euro
Marlen Haushofer: Die Wand. Ullstein/List, 288 Seiten, 10,00 Euro
Carl Amery: Der Untergang der Stadt Passau. SüdOst Verlag, 112 Seiten, 12,90 Euro
Guido Morselli und Jürgen Domian sind nur noch antiquarisch erhältlich





Tonio Schachinger: Nicht wie ihr ****
Kremayr & Scheriau (Wien 2019)
302 Seiten, 22,90 Euro
Der Doppelpass zwischen Literatur und Fußball ist bislang selten erfolgreich gespielt worden. Nick Hornby landete mit „Fever Pitch“, dem Tagebuch eines Fans von Arsenal London, einen Bestseller, Ror Wolf sammelte in „Das nächste Spiel ist immer das schwerste“ die Sprach-Floskeln dieser Sportart, Michel Decar schrieb ein witziges Monodrama über „Philipp Lahm“ und Nobelpreisträger Peter Handke bewies mit seinem „Gedicht“ über die „Aufstellung des 1. FC Nürnberg vom 27.1.1968“ und seinem Romantitel „Die Angst des Torwarts vor dem Elfmeter“ dass er zu diesem Massensport lediglich eine textkritische Affinität hat.
Doch nun wagt sich mit dem 27jährigen Tonio Schachinger ein junges österreichisches Nachwuchstalent auf das Spielfeld, bringt bei einem kleinen österreichischen Verlag den Roman „Nicht wie ihr“ heraus und schafft es auf Anhieb in die Shortlist des renommierten Deutschen Buchpreises 2019, also praktisch auf die Plätze 2 - 6 der deutschsprachigen Literatur-Bundesliga - mit der Berechtigung zur Teilnahme an der BCL (Book Champions League)?
In 48 fesselnden Kapiteln erzählt Schachinger die Geschichte des (ebenfalls 27jährigen) Fußballstars Ivo Trifunović, einem Österreicher mit bosnischen Vorfahren, erfolgreich in der Premier League beim FC Everton und in der österreichischen Nationalmannschaft, einer sehr realen Kunstfigur, die aus etwa 75% Mark Arnautović, 15% Franc Ribery und 10% Jerome Boateng besteht. Der geniale Kniff ist dabei die doppelte Erzählperspektive: zum einen spricht und denkt Ivo in der distanzierten Er-Form über sich selbst, über einen Proleten, „der sich nur für Autos und Silikontitten interessiert“ und der doch gerne ein treusorgender, glücklicher Familienvater für seine attraktive Frau Jessy und die beiden kleinen Kinder wäre. Zum anderen mischt sich immer wieder der Autor als Zweit-Beobachter ein, hebt damit das Reflexionsniveau und liefert schöne Breitseiten gegen den Sportjournalismus (fade „Schreibtisch-Cowboys“), gegen die Funktionärs-Clique und gegen die verlogenen Mythen dieses Sports: „Um gut zu werden muss man den Fußball nicht lieben, man muss ihn aushalten“.
Bei der Lektüre fühlt man sich manchmal an den Satz von Ludwig Harig erinnert: „Das, was im Leben passiert, ist so wie am Samstag beim Spiel“. Kapitalismus, Aggression, empathiefreies Macho-Gehabe, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus - all das spiegelt sich im Profifußball (oder umgekehrt?). Zwei Ereignisse bringen dann aber Ivo von seiner Ich-denke-nur-von-Spiel-zu-Spiel-Routine ab: als Mirna, sein zweimaliger One-Night-Stand, die Beziehungs-Kündigung cool hinnimmt und ihn nur als „Scheiß-Narzissten“ bezeichnet und als der Everton-Präsident Vincent Khan nach einem Spiel mit dem Hubschrauber abstürzt, in dem beinahe Trifunovićs Frau und Tochter mitgeflogen wären. Doch ein romantisches Happy End wäre für diesen Roman zu billig: Ivos Buch-Karriere endet mit einem Wechsel zu AS Rom und einem Spiel gegen Genua, bei dem er viele Chancen vergibt und sogar die Rote Karte bekommt.
Auch ohne Videobeweis kann festgestellt werden: ein höchst lesenswerter Einblick in die Welt des Profifußballs, der in allen Mannschaftsbussen als Audio-Datei für die stylischen Kopfhörer der Spieler präsent sein sollte.
https://www.kremayr-scheriau.at/bucher-e-books/titel/nicht-wie-ihr/

Christiane Neudecker: Der Gott der Stadt ****
Luchterhand (München 2019)
ca. 663 Seiten, 24,00 €
Nach der kleinen und wenig spektakulären "Sommernovelle" legt die in Nürnberg aufgewachsene Christiane Neudecker nun ihren zweiten autobiographisch eingefärbten Roman vor, der sich dank der Erzählfreude der Autorin zu einem opus magnum ausgewachsen hat. Beruhte die "Sommernovelle" auf den Erfahrungen der 16jährigen Schülerin bei einem Vogelschutz-Projekt auf Sylt, so ist der "Gott der Stadt" das literarische Extrakt der 21jährigen Regie-Studentin bei der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch im Berlin der Nachwendezeit.
Unter dem Alias-Namen der Ich-Erzählerin Katharina Nachtrab (die ihren Nachnamen unbedingt als Nacht-rab betont sehen möchte) beschreibt Neudecker den Regie-Jahrgang 1995 - bestehend aus fünf StudentInnen -, dem der Professor Korbinian Brandner ein ambitioniertes Projekt zur Aufgabe stellt: aus dem Faust-Fragment des Dichters Georg Heym, das gerade mal drei höchst verrätselte Seiten umfasst, soll eine szenische Umsetzung gestaltet werden, die dann am 84. Todestag (Heym starb am 16. Januar 1912 beim Schlittschuhlaufen auf der Havel) öffentlich aufgeführt wird. Damit begeben sich nun allerdings alle Beteiligten wirklich auf dünnes Eis, denn die Heym-Recherche entwickelt sich zu einer Gratwanderung zwischen Leben und Tod, zu einem faustischen Experiment der Annäherung an den Teufel, zu einer problematischen Auseinandersetzung mit dem ambivalenten Genie Georg Heym und zu einem Macht- und Beziehungsspiel mit tödlichem Ausgang. Durch die düstere Fiktion scheinen immer wieder reale Versatzstücke durch, auch wenn die Hochschule im Roman den Namen "Erwin Piscator" trägt. Professor Brandner hat unübersehbare Züge des bekannten Regisseurs Manfred Karge, der übrigens 2012 das Faust-Fragment tatsächlich in Berlin zur Aufführung brachte. Und bei einer heftigen Studentenparty gibt es auch einen kurzen (anonymen) Auftritt von Lars Eidinger, der damals zusammen mit Fritzi Haberlandt, Nina Hoss, Devid Striesow und Mark Waschke eine legendäre Schauspieler-Klasse bildete.
Christiane Neudecker erweist sich als Meisterin einer magischen Erzählweise mit der Fähigkeit zu hochdramatischen Zuspitzungen und existenziellen Momentaufnahmen. Es gibt jedoch ein paar Passagen, in denen die inflationäre Zurschaustellung von Gemütszuständen der Ich-Erzählerin gekünstelt wirkt, wo eben dann sehr erwartbar das Herz "bis zum Hals" schlägt, wo die Augen zu tränen beginnen, die Brust brennt, die Luft fast wegbleibt, die Kehle trocken wird und die Knie zittern. Da fürchtet man als Leser kurzzeitig, sich in das Abenteuerbuch "Fünf Freunde und die Suche nach (Achtung Kalauer!) Georgs Geheymnis" verirrt zu haben. Zum Glück pendelt das Geschehen immer wieder in die spannende Realität des Jahres 1995 zurück, zu der besonderen Atmosphäre der von Ost-West-Spannungen geschüttelten Hauptstadt Berlin, zu den Machstrukturen einer elitären Theaterschule (20 Jahre vor der #MeToo-Debatte) und zu den unappetitlichen Leichen im Keller der DDR-Vergangenheit.
Wer das bunte Theaterleben luftig und schön ironisch miterleben will, ist mit Joachim Meyerhoffs "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" besser bedient. Wer aber den Blick auf die Abgründe der Zunft richten will, erhält von Christiane Neudecker einen fesselnden Einführungskurs.

Thomas Klupp: Paradiso ****
Berlin Verlag (München/ Berlin 2009)
ca. 193 Seiten, 10,00 € (Tb)
Thomas Klupp: Wie ich fälschte, log und Gutes tat ****
Berlin Verlag (München/Berlin 2018)
ca. 250 Seiten, 20,00 €
Die Geschichte des deutschsprachigen Schelmenromans bekommt nach Simplicissimus, Felix Krull und Oskar Matzerath mit den beiden Prosawerken von Thomas Klupp zwei interessante neue Protagonisten. Der etwa 25jährige Alex Böhm und der knapp 16jährige Benedikt Jäger stehen in dieser Tradition exemplarisch für den postmodernen Schelm des 21. Jahrhunderts. Sie verkörpern den Typus des (ewigen) Jugendlichen, der sich als gleichzeitiger Antiheld und Anti-Antiheld von verschiedenen gesellschaftlichen Strömungen treiben lässt, Beziehungen mit dem Diktat der relativen Unverbindlichkeit gestaltet, eine konsequente Konsequenzlosigkeit an den Tag legt und sich mit den Parolen „anything goes“ und „Let it be“ irgendwie durchwurstelt.
Klupps Debütroman „Paradiso“ schildert etwa 24 Stunden im Leben des Alex Böhm (= der Erzähler), der in Potsdam das Schreiben von Filmdrehbüchern studiert und zu seiner Freundin Johanna nach München will, um mit ihr einen Portugal-Urlaub anzutreten. Allerdings hat Johanna sein Auto zu Schrott gefahren, deshalb muss er die Strecke Potsdam - München als Tramper bewältigen. Daraus ergibt sich ein originelles Stationen-Drama mit ungewöhnlichen Begegnungen. Er sitzt in einem Audi TT, einem Kühltransporter, einem bunt bemalten Kastenwagen, einem Taxi, dem Auto seine Mutter und dem Auto eines älteren Mannes. Er trifft auf den alten Bekannten Konrad, auf den LKW-Fahrer Roland, die Kunststudentin Patrizia, auf alte Bekannte, wie auch auf seine Ex Leni. Er besucht eine Erothek auf einem Autohof, es verschlägt ihn in seine Heimatstadt Weiden, wo er dann spontan eine Party am Baggersee aufsucht, er sucht Hilfe in einem Gotteshaus nahe München und landet schließlich gerade noch rechtzeitig am Flughafen München-Erding. Irgendwann erkennt er, dass der „Verlauf dieses Tages wie eine Art Zeichen oder wie ein Schicksal ist“, dass er also diesem Sich-Treiben-Lassen ein Ende setzen sollte: „Vielleicht werde ich jetzt ein besserer Mensch“. Doch am Ende lässt sich das Über-Ich des Drehbuchschreiber und versteckten Autors nicht leugnen: „Ich meine, es ist besser, Geschichten komplett zu erfinden, als mit Halbwahrheiten hausieren zu gehen“.

Schon im Titel seines zweiten Romans kündigt Thomas die Fortsetzung dieser Leitmotivik an. Diesmal ist die Hauptperson (und der Erzähler) der knapp 16 jährige Benedikt Jäger, der in tagebuchartiger Form über gut drei Monate (13. September - 23. Dezember) Bericht erstattet. Er ist Schüler am Kepler-Gymnasium Weiden und durchlebt die typischen Situationen eines Coming-Of-Age-Schicksals. Sportliche Erfolge mit der Schultennismannschaft, heftige Notenprobleme in den naturwissenschaftlichen Fächern, Beziehungs-Krisen mit Marietta und Margarete sowie ambivalente Erfahrungen mit Drogen und Anti-Drogen-Kampagnen. Zur Absicherung seiner schulischen Existenz startet er eine atemberaubende Fälscher-Karriere, die ihn am Schluss sogar zu einem Einbruch beim Physiklehrer Dr. Scharnagl treibt. Zur finalen Suizid-Konsequenz eines Schülers Gerber (Friedrich Torberg) versteht er sich freilich nicht. Heimliches Vorbild seiner Sein-Schein-Problematik ist die lebenslustige Mutter, eine begnadete Lügnerin und Eindruck-Schinderin. Recht gespalten ist auch sein Blick auf die Heimatstadt Weiden: einerseits „eine super Stadt“, andererseits, ein provinzielles „Trugbild“. Man kann gar nicht anders, als diesen „Dschägga“ irgendwie sympathisch zu finden und sich von seinen Ausführungen, die in einem Mix aus Jugendsprache und Sprache des Verfassers angelegt sind (erinnernd an Bov Bjergs „Auerhaus“), einfangen zu lassen. Er hat natürlich nicht die dramatische Weltsicht eines Törleß oder eines Moritz Stiefel, ist näher an der Nonchalance eines Holden Caulfield und damit ein authentischer Repräsentant unserer eher banalen Gegenwart.

Jonas Lüscher: Kraft (Roman, 2017) *****
München 2017 (C. H. Beck Verlag)
235 Seiten, 19,95 € (geb.)
Richard heißt zwar mit Nachnamen Kraft, doch dieselbe hat den Mittfünfziger offensichtlich verlassen. Er steht zutiefst verunsichert vor einem privaten und beruflichen Scherbenhaufen. Mit einem letzten Kraft-Akt will der von Selbstzweifeln geplagte Philosophie-Professor noch einmal die Millionen-Frage nach dem Grund für Optimismus in der heutigen Zeit beantworten, aber dann entscheidet er sich lieber für einen spektakulären Showdown.
Jonas Lüscher, der es 2013 mit seiner intelligenten Novelle über die Abgründe des Finanzkapitalismus („Frühling der Barbaren“) in die Longlist des Deutschen Buchpreises schaffte, legt nun den ersten Roman vor, eine brillante, analytische Satire über den transatlantischen Wissenschaftsbetrieb und über die Dilemmata des intellektuellen Neoliberalismus. Richard Kraft blickt aus dem Heute auf eine seit den 1980er Jahren geschmeidig verlaufende Universitätskarriere: zuerst profiliert sich der Berliner VWL-Student als Reaganomics-Fan und Lambsdorff-Liberaler, zuletzt wird er als Nachfolger von Walter Jens auf den Lehrstuhl für Rhetorik in Tübingen berufen. Aber auch drei gescheiterte Beziehungen (Ruth, Johanna und Heike), die ihn finanziell ruiniert haben, stehen zu Buche. Der Denker-Wettbewerb an der Stanford University, den ein visionärer Unternehmer aus dem Silicon Valley mit einem Preisgeld von einer Million Dollar ausgestattet hat, motiviert ihn zu einer letzten intellektuellen Anstrengung. Es soll der Satz „Alles was ist, ist gut, und warum können wir es dennoch verbessern“ philosophisch in einem 18-Minuten-Vortrag begründet werden. Mit analogem Copy & Paste (= Papier, Tesafilm und Schere) schustert sich Kraft in der kalifornischen Uni-Bibliothek ein gedankliches Konstrukt zusammen, von dem er am Ende sagt: „was für eine ausgedachte Hühnerkacke“. Damit wird er endgültig zum „Habe-nun-ach …“-Faust des 21. Jahrhunderts, der vergeblich nach einer irgendwie stimmigen Lebens-Konstruktion sucht; wie dieser greift er letztlich zu der tödlichen „Befreiung“ - nur läuten zu seiner Rettung keine Osterglocken!
Lüschers kühne Satzbau-Konstruktionen, seine bildreiche Sprache, die zusammengetragenen Lesefrüchte (von Isaiah Berlin über Odo Marquard bis zu Joseph Vogl) sowie die authentische Erfahrung einer abgebrochenen Dissertation entfalten einen gewaltigen erzählerischen Sog, der die Leichtigkeit eines Joseph von Westfalen mit der Zeitkritik eines Hanns-Josef Ortheil verbindet. Wenn der Gesellschafts-Beobachter Jonas Lüscher einmal selbstironisch seinen Protagonisten Kraft als „Schwafler“ charakterisiert, ist viel über den Zustand der gegenwärtigen postfaktischen Kommunikationsstrukturen gesagt. Vielleicht schafft es Lüscher ja mit diesem vollständig gelungenen Roman-Wurf in die Shortlist 2017! Und wenn nicht, hat er dafür zumindest den Dr. h.c. verdient!
http://www.chbeck.de/Luescher-Kraft/productview.aspx?product=17627187
